 |
|
 |
 |
Login
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 25 Feb 2010 23:36 Titel: Episode 14 – Eide Teil 2 Verfasst am: 25 Feb 2010 23:36 Titel: Episode 14 – Eide Teil 2 |
|
|
Episode 14 – Eide Teil 2: Baumkuschler
21. Eisbruch 253
Auf Menek’Ur und im Nebelwald
Ein ganz eigener Duft lag in der trocken-heißen Luft der wohl saubersten Stadt, die es an den Küsten der Weltmeere gab.
Menek’Ur Stadt war die Residenz des menekanischen Emirs und zugleich eine der wichtigsten Handelsmentropolen des Südmeers überhaupt, das Salz, das die Sandfresser aus den Felsformationen tief in der Wüste herausschlugen hatte sie reich gemacht. An Tagen wie dem heutigen konnte man das als Auswärtiger am unverfänglichsten und freigiebigsten beobachten.
Es war Markttag auf Menek’Ur, oder wie die Einheimischen zu sagen pflegten: „Suq“ oder „Basar“.
Die gepflasterten, sauberen Straßen führten den Gast schon beinahe unweigerlich auf den zentralen Marktplatz (oder Basar.. wie auch immer), auf dem emsiges Treiben herrschte, wie es nun einmal für Märkte üblich war. Nur war es hier anders, als auf Geirmor: Die Farben waren prächtiger und bunter, die eingangs erwähnten Gerüche trachteten förmlich danach, sich im gegenseitigen Wettstreit des Wohlgefallens für die Nase zu übertrumpfen, dass einem beinahe der Schwindel kommen konnte: Da war Lavendel, das herrliche Odeur der orientalischen Parfums (Jacky hätte da nur die Nase gerümpft, das war schließlich Zeichen der „gepuderten Pfeffersäcke“) während Gewürze wie Muskat dem Ganzen die nötige Rasse gaben. Ich hatte mich an diesem Tag mehrmals dabei ertappt, wie ich in alte Muster aus meiner Kaufmannszeit zurückzufallen drohte und hatte mich ebenso oft zur Ordnung gerufen – die reichen finanziellen Mittel einer Handelsgesellschaft hatte ich nicht mehr im Rücken. Und mein Gold wollte ich dafür auch nicht ausgeben.
Denn vor einigen Wochen hatte die Bruderschaft den Schmugglerposten auf Menek’Ur erweitert und ausgebaut, um uns den Zugang zu den menekanischen Spirituosen (ich möchte hier dem Leser lobend den vorzüglichen Kaktus-Schnaps empfehlen), Teppichen und so weiter, aber ganz besonders dem Salz offen zu halten.
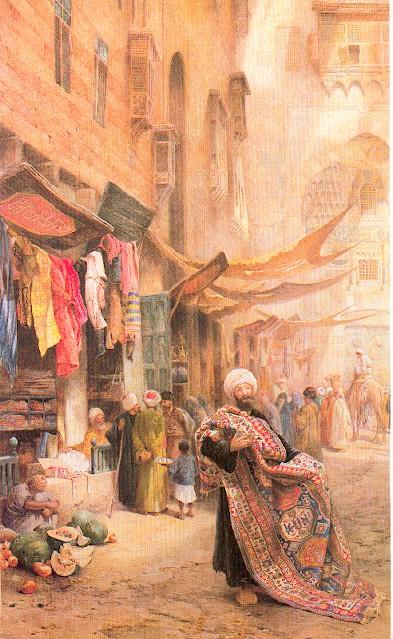
Nach einer Weile des Flanierens, denn ich alter Geizhals kaufte ja doch nichts, entschloss ich mich, wieder Richtung Hafen zu gehen und mich abzusetzen. Die trockene Hitze hier mochte ich ohnehin nicht sonderlich, das feucht-warme Klima auf La Cabeza war mir da um Längen lieber!
Zudem begannen die menekanischen Wachleute – diese Sandfresser wirkten viel disziplinierter und stolzer als „unsere“ Reichssoldaten – mich misstrauisch zu beäugen: So ein Schlitzohr war eben nicht unbedingt eine Freikarte.
Am Hafen traf ich zu meiner Überraschung meine Gefährtin an. Erwartungsgemäß beim Angeln.
Unwillkürlich musste ich schmunzeln, während ich zu ihr trat und ihre Begleiterin kurz musterte, selbst hier auf Menek’Ur in der Fremde musste sie ihre Angel auswerfen! Die andere Frau stellte sich als Kalindra, Sarah... oder wie sie sich nun einmal gerade nannte heraus. Ein grobes Mannsweib, das mir nicht geheuer war. Wobei ich ihr zugestehen musste, gut in eine Entermannschaft zu passen – nur mit der See hatte sie es glaube ich nicht sonderlich. Aber das war auch nicht weiter von Belang.
Jacky hatte ganz offensichtlich kräftig eingekauft: Sie war in eine dieser weiten Pluderhosen des Wüstenvolkes gekleidet, die aus hauchdünnem Stoff bestanden – angenehm bei den herrschenden Temperaturen. Darüber trug sie eins dieser leichten kurzen, ärmellosen Kleider die ich so sehr an ihr mochte – wie die Hose diesmal in Sandfarben. Wie so oft musste ich mir auch hier eingestehen: Es stand ihr vorzüglich.
Gemeinsam begaben wir uns auf die Rückfahrt nach Gerimor, wo Jacky und ich uns direkt – wieder in warmes Wintergewand eingehüllt, auf den Weg nach Norden machten, Richtung Nebelwald.
Der Nebelwald.

Dieses dichte Gehölz bedeckt den ganzen Norden Geirmors, weit jenseits der rahalischen Territorien und viele hundert Meilen nach dem Wegkreuz.. Schon von weitem kann man die Silhouette des Waldes sehen: eine dunkle, von einer dichten Nebelglocke überlagerte Wand am Horizont – von einem Ende zum anderen, geschlossen, undurchdringlich wirkend. In der Tat hatte sich seit dem Bruderkrieg vor so langer Zeit, als sich die Orks in diesen Wald gewagt und von den Elfen massakriert worden waren, kaum eine Seele tiefer in diesen Wald gewagt, als an oder in den Waldrand hinein. Es war ihnen auch nicht zu verübeln, denn die Bäume standen so dicht wie in kaum einem anderen Wald auf Geirmor, das Unterholz war verwuchert und es gab so manche absonderliche Eigentümlichkeit in diesem Forst: Es wurde von Irrlichtern berichtet, die schon in archaischer Zeit die Orks in dne Tod geführt hatten, von den merkwürdigsten Vogelarten und, was ich persönlich am aufregendsten und fürchterlichsten finde, von lebenden Bäumen! Von alldem weiß natürlich nur der geringste Teil der Menschen und das meiste von dem, was die wenigen Kundigen zu wissen glauben, ist wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit, doch eines ist gewiss: Dieser Wald lebt!
Und Jacky und ich hatten nichts Besseres zu tun, als schnurstracks hinein zu marschieren.
Meine Gefährtin hatte nämlich vor ein oder zwei Wochen einen Traum über ihre alte Freundin, wenn man es so nennen konnte, Dhran gehabt. Eine vermeintlich ertrunkene Magiefuchtlerin, die offenbar doch nicht so mausetot war, wie Jacky gedacht hatte. Und sich nun einen Spaß daraus zu machen schien, sie mit solchen miesen Maschen auf Trab zu halten. Verabscheuungswürdig, diese Magiefuchtler – die waren ja obendrein noch der größte Feind jedes Segelschiffs! Jedenfalls die Kriegsmagier…
Kurzer Rede kurzer Sinn, laut dieser Traumbotschaft musste sie in „Ered Luin“ gewesen sein. Jacky hatte es nicht viel gesagt, doch ich kannte diesen Ort, zumindest dem Namen nach, wir waren schon des Öfteren entlang der Küste daran vorbei gefahren: Die Heimat der Langohren, oder politisch korrekt und den Gelehrten unter uns zum Wohlgefallen auch „Elfen“ genannt. Da gab es die hochnäsigen und mächtigen im Volksmund als Hochelfen bezeichneten Abkömmlinge, als auch jene, die in den Wäldern hausten und so grün waren, wie die Blätter, in denen sie sich verbargen, die Waldelfen. Freilich hatte ich in meinem bisherigen Leben nur zwei oder drei dieser Wesen gesehen und wirklich mit ihnen zu tun hatte ich nie, sie waren ja eine Sache für sich! Es heißt, sie würden mehrere hundert, ja tausend Jahre alt werden. Ein Menschenalter war für sie nicht mehr als ein Kinkerlitzchen. Das erklärte auch ihre Arroganz gegenüber all den anderen Völkern: Sie waren ihnen (jedenfalls den meisten) an Erfahrung und Wissen schlicht überlegen, wer wäre da nicht arrogant geworden?
Wir gingen an diesem Tage also schnurstracks in den so trefflich als Nebelwald bezeichneten Forst hinein, um durch unsere niedere Anwesenheit diese arroganten Urgesteine hinter ihren Blättern hervorzulocken, auf dass sie uns „Kinder“ begaffen konnten. Und wir sie so aus der Reserve locken könnten. Oder so ähnlich.
Schon nach wenigen Schritt wurde es dunkel um uns herum und eine Kälte, wie sie für dichte Wälder so typisch ist, umgab uns. Das holzige Odeur des Waldes mischte sich mit seiner ganz eigenen Geräuschkulisse und schollt unsere Versuche, ein Zeitgefühl zu behalten, Narretei. Tatsächlich wussten wir schon bald weder, wohin wir eigentlich gingen, noch wie lange wir schon unterwegs waren. Es konnten Stunden sein, aber auch nur Minuten.. jedenfalls sah es um uns herum stets ziemlich gleich aus. Recht schnell hatten wir das Gefühl bekommen, beobachtet zu werden. Irgendetwas war dort im Unterholz, oder spielte uns das Unterbewusstsein nur einen Streich?
Irgendwann hielten wir inne, um zu pausieren und da bekamen wir abrupt Gewissheit.
Fließend, einem Fluss, der sich um Steine elegant herumwand gleichkommend, trat ein hochgewachsener Elf aus dem Unterholz hervor, nur wenige Fuß von uns entfernt, um uns misstrauisch zu mustern. Erschrocken standen wir nahe beieinander, wir hatten ihn weder gehört noch kommen sehen. Der Hochelf stellte sich als ein Vertreter seiner Art heraus, mit dem Jacky in Menek’Ur zusammengetroffen und wenig glücklich auseinander gegangen war (sie hatte ihn angesprochen, während er Harfe spielte, das hatte ihn unglaublich beleidigt.) und so überließ sie es lieber mir, mit ihm zu sprechen. Ohnehin schien er Jacky, nachdem er sie erkannt hatte, zu ignorieren.
Nachdem ich uns vorgestellt und ihn unserer friedlichen Absichten versichert hatte, bat ich um die Gastfreundschaft seines Volkes. Ganz der Kaufmann, der ich einmal gewesen bin. Mein Onkel wäre stolz auf mich (nicht, dass meine Leser mich falsch verstehen: bei der Vorstellung kommt mir die Galle hoch). Erst, nachdem er uns streng darauf hingewiesen hatte, unbedingt den hiesigen Gepflogenheiten zu entsprechen, die er uns auch gleich aufzeigte, ging er mit uns los. Der Elf hatte sich zwar vorgestellt, doch den Namen weiß ich nicht mehr wiederzugeben, dieser dem Elfenvolk eigene Singsang als Sprache.. ist so gänzlich verschieden zu den Mundarten der Menschenvölker, dass man mir dieses Lapsus nachsehen möge. Zu dritt ging es nun also weiter durch den Wald – diesmal waren wir genauestens darauf bedacht, nicht irgendwelche Pflanzen zu zertreten (soweit es eben bei dem reichlichen Bewuchs möglich war) oder sonst irgendwie das Missfallen des Elfen zu erwecken. Als besonderes Schmankerl begegneten wir einem der lebenden Bäume – Baumgeister, die ihre Wurzeln zur Fortbewegung verwendeten und fürchterlich und faszinierend zugleich anzusehen waren. Jacky und ich mussten uns im wahrsten Wortessinne von diesem Anblick losreißen und allen Mut zusammennehmen, um den Baum überhaupt zu passieren. Dann ging es auch schon weiter.
Es wurde heller.
Und tatsächlich waren wir bald wieder am Waldrand angekommen, wo uns der Hochelf in einen verfallen wirkenden Ballustradenbau führte, dessen Wände zwar verwachsen, der glatte weiße Marmor aber glänzte, wie ehedem.
Überhaupt hatte die hochelfische Architektur der menschlichen eines voraus: In Sachen Marmorverarbeitung waren sie großmeisterlich. Selbst in diesem überwucherten Zustand wusste er zu beeindrucken.
Dort erklärte sich der Hochelf bereit dazu, unsere Fragen zu beantworten, die wir doch seine Weisheit suchten. Zwar war es doch nicht so hochgestochen, doch mir war bewusst, ass er sich damit gebauchpinselt fühlte und somit kooperativer sein würde.
Wie sich herausstellte, war tatsächlich eine Frau im Nebelwald gewesen, deren Beschreibung auf Dhran passte. Da übernahm Jacky nun endlich das Gespräch, der Elf zeigte sich sogar bereit, mit ihr zu reden, als sei nichts gewesen. Er musste ihr verziehen haben. Allzu viel bekam ich vom weiteren Gespräch nicht mit, denn ich befasste mich mit dem Taxieren der Architektur, des Elfen, seiner Tracht und seiner Harfe. Wollte diese Eindrücke in mich aufnehmen. Das Schicksal dieser Dhran war mir indes gleichgültig, wieso also hinhören?
Schließlich wusste Jacky, was sie wissen wollte und der Elf ihr sagen konnte, denn das Langohr verabschiedete sich von uns und verschwand so plötzlich, wie er erschienen war.
Auf dem Heimweg nach Rahal trennten wir uns, Jacky wollte noch ein wenig alleine sein, um über das, was sie gehört hatte, nachzudenken. Was mich anbetraf, so würde ich zuhause den Kamin anfachen und Grog vorbereiten, um uns den Abend so gemütlich wie nur möglich zu machen. Zu zweit.
Hoffentlich würde diese Dhran doch noch ersaufen.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II
Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 27 Feb 2010 19:46, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 02 März 2010 17:11 Titel: Episode 15 – Missverständnisse Verfasst am: 02 März 2010 17:11 Titel: Episode 15 – Missverständnisse |
|
|
Episode 15 – Missverständnisse
28. Eisbruch 253
Im Rahaler Hafenviertel
Als ich heute nichts Böses ahnend gegen Abend zurück ins Krähennest kam, traf mich halb der Schlag: Unsere kleine lauschige Hütte war rappelvoll. Das ist vielleicht etwas übertrieben, es waren ja nur drei Mann (d.h. Frauen), doch die Schmerzgrenze in der fast fensterlosen Bude mit niedriger Decke war recht schnell erreicht, wenn es um angenehme Atemluft ging.
Ionna und Iriel waren zu Besuch bei Jacky und hatten sich wahrscheinlich über irgendetwas unterhalten, das für Männerohren nicht bestimmt war, denn als ich eingetreten war hatte Iri nahezu erschrocken zur Haustür gespäht. Ob da nun etwas dran war oder nicht, konnte ich freilich nicht ausmachen, da man mich allenthalben zu begrüßen pflegte und ein neues Thema anschnitt: Salz.
Ich hatte noch nicht einmal meine gefütterte Lederjacke ganz ausgezogen und an den Haken an der Wand gehängt, als Jacky mir eröffnete, dass Ionna Salz brauchen würde. Logisch, als Schneiderin und Gerberin brauchte man Salz, doch was hatte ich damit zu tun?
Tatsächlich stellte sich rasch heraus, dass bereits Kontakte zu menekanischen Salzhändlern geknüpft worden waren, womit für mich das Thema abgehakt war.
Da für den Salzhandel zur See gefahren werden musste, war der Übergang zum nächsten „Tagesordnungspunkt“ nicht sonderlich überraschend – Elfie. Die mütterliche Führerin der Elstern war vor vielen Wochen unvermittelt aufgebrochen, um ihr verschollenes Kind oder was auch immer zu suchen und dabei nach allen Regeln der Kunst mit dem Schiff, auf dem sie mitfuhr, abgesoffen. Zu ihrem Glück und unserer Erleichterung konnte sie sich zusammen mit dem Kapitän des Kahns auf eine nahegelegene Insel retten Auf der saß sie seitdem fest und nur durch Zufall hatten wir überhaupt von der Sachlage erfahren, indem uns eine Flaschenpost von Elfie in die Hände fiel. Zufälle gab es, die würden einem die Leut‘ am Stammtisch nur schwer glauben wollen, doch so war es! Seitdem waren jetzt schon viele Wochen vergangen und meine Freunde der Elstern begingen den Fehler, der den meisten Landratten zu unterlaufen pflegte, wenn sie von unbewohnten Südseeinselchen hörten: Sie dachten an ein Paradies. Für denjenigen, der auf solch einem Eiland strandete und versuchen musste, sich halbwegs am Leben zu erhalten, war von einem Paradies allerdings keine Rede. Und so hielt ich den Träumereien der anderen dagegen, mit der Mahnung, dass wir sie möglichst bald finden müssten, da die Chance sonst nur steige, sie nicht mehr lebend anzutreffen. Wenn wir nämlich schon in den südlichen Meeregefilden waren, könnten wir auch gleich noch ein wenig nach ihr forschen.
Plötzlich tat es einen Rums und Jacky lag, alle Viere von sich gestreckt flach. Die Pulle Rum in ihrer Hand zeugte noch von dem Prosit, dass sie in die Runde getan hatte, ehe sie davon getrunken – und es sie umgehauen hatte. Ich dankte sämtlichen Meeresgeistern, dem Klabautermann und einen kurzen Augenblick war ich sogar geneigt, auch die Sirenen zu erwähnen (ließ es aber dann doch bleiben), dass Jacky nicht vor den Augen meiner Kameraden von_einer_Flasche_Rum ausgeknockt wurde, ich wäre ja im Boden versunken! Während Ionna so ihre Witze über Jacky riss, es war offenbar nicht das erste Mal, dass sie umkippte heute, beugte ich mich über sie drüber und gab ihr ein paar milde Klapse auf die Wangen. So amüsant es auf den ersten Blick auch gewesen war, jetzt wurde mir doch etwas mulmig.
Zu meiner Erleichterung kam sich bald wieder zu sich und lamentierte über den Rum, den sie da gesoffen hatte. Sie hatte wohl eine der Flaschen erwischt, die das hervorragende Gebräu vom alten Stede beinhalteten – der alte Pirat hatte ein Händchen für die Rumbrennerei – und so wunderte ich mich zu einem gewissen Teil gar nicht mehr. Freilich war es einer der, wenn die der beste Rum, den ich kannte, wie konnte man da aus den Latschen kippen? Das war ja schon fast eine Beleidigung für den alten Silberrücken. Jackys irritierte Frage, was das denn für ein Rum sei, beantwortete ich wahrheitsgemäß als eine „Spezialmischung“ – das wurde sogleich mit einem vorwurfsvollen „Is‘ da Schalfgift drin? Speziell für die Mädels, aye?“ quittiert. Damit kam sie der Wahrheit zwar nur zum Teil nahe, aber ich kam nicht umhin, zuzugeben, dass es in unseren Reihen wirklich einige Kameraden gab, die sich wirklich um NICHTS scherten und Dinge taten, die mir trotz meiner Jahre bei Pereras Leuten immer noch abscheulich schienen – und wohl immer scheinen würden, weil sie es schlichtweg… waren.
Als man wieder auf den Salzhandel zu sprechen kam, taxierte ich Iri wieder einmal. Das junge Ding hatte sich gut von der Kugel erholt, die sie vor so vielen Monden kassiert hatte, die anfängliche traumatische (um Jackys Worte aufzugreifen. Trauma.. dass ich nicht lache!) Furcht hatte sie bereits verloren, jedenfalls glaubte ich das, so dass ein normaler Umgang mit ihr wieder möglich war. Man hatte mir sogar das lamentierende Bedauern für bare Münze abgekauft. Und nun sprach ich einen Gedanken aus, der sich mir soeben bei ihrem Anblick gekommen war: Iri könnte doch im „Badehaus“ auf Cabeza arbeiten.
Tatatatomm! Damit war die Ernsthaftigkeit des eben wieder aufgenommenen Salzhandelgesprächs wie hinfort gespült. Ionna protestierte aufs heftigste, dass ihr „Püppchen“ (Sie sah ihre kleine Schwester Iri oftmals erschreckenderweise nur als schön anzusehende Schachfigur, um reiche Männer zu angeln) in kein Badehaus gehen würde, Jacky fragte, was Iri denn dort solle, wo doch die Madame Minfay bereits dort sei. Jacky schien für den Moment amüsiert, schloss sich aber rasch der Stimmung von Ionna an und nahm dabei skurriler Weise sogar haargenau dieselbe Körperhaltung ein: Arme in die Seiten gestemmt, vorwurfsvoller Blick. Was hätte ich denn bitte damit zu tun, EH?
Scheiße.
Jetzt stand ich wohl als der große Mädchen-Angler für unseren Puff da. Das letzte, was ich wollte.
Da rettete mich ein Klopfen an der Tür, dem ich bereitwillig entgegen ging, nicht ohne noch erklärend zu meinen, völlig frei jeder Wertung, dass es für die Moral der Männer sicher förderlich wäre. Denn hübsch war sie ja doch, die Iri, von dieser Sorte unverbraucht und so.. das mochten viele Raubeine, die ich meine Kameraden nannte – natürlich sprach ich diesen letzten Gedanken nicht aus. So weise war ich. Denn schon die Äußerung über die Moral hatte Jacky dazu angeregt, es mit einer fauchenden Gegenfrage zu beantworten. Obacht, Jaron, Obacht.. du balancierst auf dünnem Eis.. ich stiefelte rasch zur Türe, um den vorwurfsvollen Blicken Ionnas und Jackys auf er einen und den zugleich irritierten wie, ich glaubte tatsächlich Amüsement zu sehen, von Iri zu entkommen. Der Gast stellte sich als Aron heraus, wie immer, wenn er hier in der Gegend war, ordentlich vermummt. Ich begrüßte ihn mit dem zum Dauer-Kalauer gewordenen Ausruf der (gespielten) Überraschung, dass er immer noch am Leben sei und ließ ihn ein. Noch ehe ich die Tür schließen konnte huschte auch Ydane herein, die wohl kurz hinter ihm gekommen war, auch sie wurde begrüßt.
Da waren wir also schon sechs – Jacky, Ionna, Iriel, Aron, Ydane und meine Wenigkeit. Jetzt wurde es WIRKLICH heimelich in der kleinen Bude! Und ebenso rasch verlor ich den Überblick über das kreuz und quer gehende Geplapper, das sich in der Folge entspann. Mir fiel dabei auf, dass Aron und Iri sonderbar vertraut miteinander umgingen – und irgendwie tat mir der arme Aron Leid, denn der wie vielte war er wohl für sie? Ich fühlte mich darin umso mehr bestätigt, als man darauf zur Sprache kam, dass es doch besser für Iri wäre, sich einen reichen Pfeffersack wie Thancred zu angeln, statt (wie die Mädels vor vorgehaltener Hand sagten) eines Nichtsnutz und Habenichts. Iri, das Püppchen, das Werkzeug. Köstlich. Aber nicht ganz so interessant, wie erhofft, denn ich verfolgte lieber das ständige Rotieren des Globus, den wir hier stehen hatten, unter Ydanes Hand in Bewegung versetzt. Interessanter als solch Weibergewäsch über ach so tolle Partien, Gold, aus Marmor gearbeitete private Bäder und was weiß ich nicht alles – obwohl, oder gerade weil diese Männer für sie unerreichbar waren. Ich würde so etwas nie verstehen. Ich hatte meine wenige, aber gepflegte Habe, einen kleinen Kutter, den Drogenhandel und Schmuggel auf rahaler Boden… ich trachtete doch auch nicht nach einem Harem von sieben Frauen, die eine für die Wäsche, die andere zum Kochen, der Rest für leibliche Freuden nach eigenem Gusto?! Frauen…
Da hörte ich erneut das Wort „Badehaus“ fallen und es brauchte einen kurzen Moment, bis ich den Zusammenhang begriff: Sie hatten in ihrer unendlichen Weisheit bemerkt, dass so versiffte Penner wie sie wohl kaum einen der reichsten Männer der Grafschaft täuschen würden könnten und somit etwas an ihrem Äußeren würden verändern müssen. Iri hatte dazu den Besuch des Badehauses vorgeschlagen, zum Waschen, Ölen und was so dazu gehörte, um – wenn ich die Worte meines Vaters aufgriff, möge er in Frieden ruhen – wirkliche Menschen zu werden. Ich übertreibe an dieser Stelle natürlich maßlos, der geneigte Leser wird mir meinen Humor sicher verzeihen – wobei ich mir bei weiblichen nicht ganz so sicher bin. Tatsächlich stand es nicht gar so schlimm um die Damen, Iri war in der Tat einfach schön und ich war schließlich nicht umsonst Jacky verfallen.. nichtsdestotrotz waren sie weit davon entfernt, in feiner Gesellschaft bestehen zu können. Ich konnte ein Lied davon singen, hatte ich mich doch meine ganze Jugend hindurch in solcher herumquälen müssen, ehe es mir gelang, ihr auf See zu entkommen.
Somit unterstützte ich Iri begeistert in ihrem Vorschlag, ein Badehaus aufzusuchen. Vielleicht würde sich Jacky ja sogar überzeugen lassen, endlich einmal mit ihm in so ein Haus zu gehen. Sie war etwas prüde, was dieses Thema anging (nicht in allen Badehäusern warne nur alte, dicke, notgeile Säcke…). Ionna gefiel es aus bekannten Gründen nicht und Jacky befand sich auf ihrer Seite, wenn auch aus anderen Gründen. Aron war irgendwie etwas gedankenversunken, doch in Ydane fanden wir einen weiteren Parteigänger für das Badehaus. Waren es schon drei. Wie sich schnell herausstellte, entwickelte sich das Ganze für mich zu einem Alptraum.
Ionna keifte mich abrupt an, dass ich es wohl gerne sähe, wenn sich Iri vor mir entblößte, dass ich da schon für zahlen müsse. Noch ehe ich überhaupt etwas antworten konnte hatte ich schon das Knie von der hinter mir sitzenden Jacky im Rücken, begleitet von einem langgezogenen „Achsoooo“
Na toll. Nach der Sache mit dem Arbeiten bei Minfay war ich mit diesem Vorwurf (ich hatte nie gesagt, dass ich das Kindchen nackt sehen wollte, verdammt!) endgültig im Arsch. Abgestempelt als ein Weiberheld, der ich gar nicht war. Iri war recht rasch zu ihrem und Ionnas Haus davon geeilt, um ein Handtuch zu holen, wie sie sagte – mit Ionna auf den Fersen, die ihr das immer noch ausreden wollte. Das waren zwei Schwestern, unglaublich.
Ydane und Jacky zeigten sich, während wir in der Bude zurückblieben, davon überzeugt, dass ich Iri nackt sehen wolle und deswegen Ionna bezahlen solle, ich „Schuft“. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das nicht wollte und sprach auch so – man hielt mir aber rasch dagegen, dass ich es doch selber gesagt hätte. Das war ein dicker Hund! Ich mochte vielleicht saufen, mein eigenes Kraut rauchen und Pirat sein, aber blöde war ich noch nicht. Ich wollte schließlich nur ins Badehaus, verdammt!
Selbst diese Aussage wurde mir im Munde herumgedreht, denn ich könne doch da nur hin wollen, weil ich auf dem Wege Iri entblößt sehen könne – Ydane war schlimmer, als jeder Inquisitor! Als ich das wiederholt verneinte, goss die Bäuerin noch mehr Öl ins Feuer, indem sie mir unterstellte, jetzt nur zu Finger (gemeint war Jacky) zurück zu kriechen, weil er ja nicht ins Badehaus dürfe. Und Jacky war mittlerweile so in Rage, dass sie ihr offenkundig auch noch glaubte, das sah ich ihr an, noch dazu begann sie, wie wild in unseren Lagerfässern Zeug heraus zu kramen. Die an Ydane gerichtete Frage, ob sie gegebenenfalls bei ihr unterkommen könne, stahl mir dann die letzte Farbe aus dem Gesicht. Langsam entwickelte alles eine Eigendynamik, die mir so gar nicht gefiel.
Da klopfte es.
Da gedämpfte Gezeter, das durch die Tür hereindrang verriet, dass es die Schwestern waren, die sich immer noch kabbelten, was sich bestätigte, als sie herein rauschten. Ionna wollte Iri eine lange Toga andrehen, die sie gefälligst anziehen müsse, wenn sie im Badehaus sei. Welcher Mann wolle sie denn noch, wenn sie sich so freigiebig und kostenlos allen präsentieren würde? Scheiße, die zwei waren manchmal wirklich schräg. Iri bemühte sich mittlerweile, die Toga mit ihren matschbdeckten Stiefeln am Boden zu verunstalten, während Ionna versuchte, auf Aron einzuwirken. Er, der er ja offenbar nun Nummer.. was auch immer.. für Iriel war, hätte ja vielleicht etwas gegen den Badehaus-besuch? Doch nein, Aron war es gleich, so lange sie keiner anrührte. Ich hoffte inständig, dass dieser lautstarke Schwesternstreit damit ein Ende haben würde und bemerkte bei dem ganzen Durcheinander nicht, wie Jacky immer mehr Kleidung und anderen Kram in einem Sack verstaute. Ein paar Schlucke Rums sollten mir dabei helfen, das weibische Gezeter halbwegs auszuhalten, ohne endgültig auszurasten, da bemerkte ich Jackys Tun.
Sie hatte gerade begonnen, ihre Wahrsagerei-Utensilien einzupacken, als ich zu ihr hinüberstiefelte und sie zur Rede stellte, was das denn werden solle. Sie fauchte mir entgegen, dass sie ausziehen würde und ich sah ihr deutlich an und entnahm es auch ihrer Stimme: Sie unterdrückte nur mit Mühe ein aufkeimendes Heulen. Ydanes intrigantes Geplapper drang von hinten an mein Ohr, wie sie gerade Iri gegenüber eröffnete, dass ich jene doch gerne nackt sehen würde. Langsam, ganz langsam atmete ich ein und aus, ehe mir die Kinnlade herunterklappte, als mir die Bedeutung von Jackys Worten erst richtig aufgingen. In dem folgenden kurzen Disput musste ich rasch erkennen, das ich sagen konnte, was ich wollte: Jacky hatte sich bereits ihr festes Bild gemacht, kräftig unterstützt von den Beipflichtungen Ydanes, allesamt Unterstellungen, die sich mir wie heiße Nadeln ins Fleisch bohrten. Schließlich riss sich Jacky, die ich beschwören an den Schultern gepackt hatte, von mir los und eilte überstürzt aus der Bude, barfuß, in die Kälte hinaus.
Ich wollte ihr zuerst nachlaufen und sie aufhalten, ihr klar machen, dass das Ganze reinster Nonsens war, doch ich stand wie angewurzelt vor der weit offen stehenden Tür. Die Kälte kroch bereits in den Raum herein, als ich mich betont beherrscht herumwandte und, einen Blick zu Ydane werfend, durch die Bude schlurfte. Mein Gesicht musste mittlerweile eine bleiche Grimasse von Zorn geworden sein – denn eben diesen verspürte ich mit unbändiger Kraft. Im Moment war mir gleichgültig, dass meine Kleingaunerin so leicht an mir zweifeln mochte, gleichgültig, dass Iri mich ansprach, als er an ihr und Aron vorbeirauschte. Ich griff nach meiner gefütterten Lederjacke und zog sie über, nicht, um sie zuzuknöpfen und hinaus zu eilen, Jacky hinterher.. nein. Etwas war in mir zerbrochen und gab nun den Weg frei auf das, was ich an Land nach bestem Vermögen zu unterdrücken trachtete: Die Blutgier. Iri war mir hinterher geeilt, wollte die Wogen wohl glätten, die entstanden waren, doch es war zu spät, ich wollte nur noch eines.
In einer fließenden Bewegung zog ich die Pistole, die ich liebevoll laghfearg nannte, aus dem Innenholster und spannte in derselben Bewegung den Hahn. Klick!
Bei diesem Geräusch wich Iri erschrocken zurück (etwas von dem Schrecken bezüglich Feuerrohren saß ihr wohl immer noch in den Knochen) und ich erweiterte den sich mir bildenden Korridor dadurch, dass ich sie grob zur Seite stieß. Zielstrebig eilte ich auf Ydane zu, indem ich die Pistole hob, auf sie anzulegen.

Mein Zeigefinger begann sich bereits um den Abzug zu krümmen, als Iri es irgendwie schaffte, sich vor mich zu setzen. Zwischen mich und Ydane. Ich hielt inne. Nicht wegen Iri, mir war in diesem Moment des Blutrauschs, der einen in seltenen Momenten überfiel und mir so manches Mal erlaubt hatte, meine Feigheit hinter mir zu lassen, egal, ob sie verletzt würde oder starb. Hauptsache, ich erwischte diese intrigante Schlange Ydane. Es war vielmehr eine Dolchklinge, die mir Aron von hinten an die Kehle gesetzt hatte, die mich zum Innehalten angeregt hatte: Dem vor Liebe Blinden gefiel es wohl nicht, dass ich sein Herzblatt beiseite gestoßen und nun auch noch auf sie zielte. Dabei war Iri selber schuld, wenn sie den Helden spielen wollte.
Iri schrie mittlerweile, dass ich aufhören solle und gestikulierte dabei wild herum. Ich hätte es getan, normalerweise, aber diesmal.. konnte ich nicht. Als ich das Kindchen vor Monden einmal anschoss, war es ein Versehen gewesen. Diesmal wollte ich aber schießen, auf Ydane – und nicht, um sie zu verwunden, sondern sie zu töten.
„Ich habe es satt.“
Ganz leise kamen diese Worte über meine Lippen, doch so war es. Ich hatte es satt, immer den liebenswürdig-trotteligen Krautbaron von nebenan zu mimen. Aye, ich war nicht gerade der mutigste Pirat unter der Sonne, doch irgendwo hörte bei mir der Spaß auch auf. Bei meiner críde zum Beispiel. Wer dabei half, irgendwie einen Keil zwischen sie und mich zu treiben, der konnte nicht erwarten, dass ich liebenswürdig blieb oder gnädig wäre. Eine verdammte, verfluchte Landratte schon gar nicht. Ich ahnte, was ein Kamerad mal zu mir meinte, dass man sich nicht zu sehr mit ihnen (gemeint waren die Landratten) verbrüdern sollte, das brächte nur Ärger und Frust, ahnte, dass er auf derartige Querelen abgezielt hatte. Jetzt war es zu spät.
Indes wollte ich Aron und auch Iri nichts Böses, sie traf keine Schuld (auch, wenn ich mir im Hinterkopf die Notiz machte, mir später Iri noch zur Brust zu nehmen. Das Trauma brauchte dringend eine Auffrischung, schien es mir.) und zumindest Aron war ich etwas schuldig, als dem, der mir einmal das Leben gerettet hatte. So befahl ich ihm, dass er zusehen möge, dass seine „Ische“ aus dem Weg ginge. Als hätte ich es nicht besser gewusst! Er war ein aufbrausender Choleriker, manchmal, und so presste sich die Dolchklinge stärker an meine Kehle – Ische war nun mal nicht gerade freundlich, aber beim Klabautermann, was erwartete er? Jählings stand Jacky neben Aron und presste ihm ihren Dolch, den aus Diamant, den ich ihr einmal geschenkt hatte, drohend an den Bauch. Ich frohlockte, tief hinter den Wogen von Zorn und Blutgier, meine Kleingaunerin war zurück – und wollte mir den Rücken freihalten.
Lautes, von blanker Angst in Iriels Augen begleitendes Gebrüll holte mich wieder ins Jetzt zurück: Ydane hatte sich darob pikiert, ob ich denn betrunken sei oder was der Mist sonst solle., sie hatte den Ernst der Lage wohl noch nicht begriffen. Oder war über die Maßen irre – eher letzteres, denn sie wollte sogar vor Iriel hintreten, damit ich es doch tue, wonach ich trachtete! Doch Iri blieb felsenfest dort, wo sie war.
Ich knirschte mit den Zähnen, um die vorn bebender Wut zitternde Hand etwas zu beruhigen, mit der ich die Pistole hielt. Zwischen den Zähnen presste ich erneut, diesmal sogar fast flehend, die Bitte gen Iri aus, dass sie doch aus dem Weg gehen möge. Hierauf gönnte ich mir einen dezenten Blick rundherum, soweit es mir möglich war, ohne den Kopf zu sehr zu bewegen – die Dolchklinge von Aron an meinem Hals verbat es. Da ging mir die Absurdität der Situation auf: Ich stand mit schussbereiter Pistole vor Iriel, die Ydane vor meinem Zugriff abschirmte, während Aron mir einen Dolch an den Hals hielt und durch eben solch einen selbst von Jacky in Schach gehalten wurde – die wiederum von einem Messer in Arons anderer Hand von Dummheiten abgehalten werden sollte. Das nenne ich mal verfahrene Situation.
Eigentlich sollten wir uns ja nicht untereinander zerfleischen, doch…
Langsam begann meine Blutgier abzukühlen, als ich diese Eindrücke in mich aufnahm. Jacky war zurückgekehrt und versuchte mir jetzt sogar den Rücken freizuhalten, war dabei selber drauf und dran, verwundet oder getötet zu werden – und dieser Umstand brachte mich dazu, einzulenken. Mich in Gefahr zu bringen war das eine, meine Gefährtin dagegen.. dazu war ich nicht bereit. Nicht wegen solch einem schnatternden, intriganten Bauernweib, wie Ydane. Nicht wegen einer Landratte. Niemals.
Und plötzlich musste ich lachen, so unglaublich unpassend es auch sein mochte, den verwirrten Blicken Iris konnte ich entnehmen, dass es weit mehr war als das. Und eben dieses Lachen brach den Bann.
Langsam, ganz langsam entspannte ich den Hahn meiner Pistole und senkte sie. Mein Atme ging immer noch stoßweise, mein Gesicht war immer noch eine Grimasse des unbändigen Zorns, doch ich beherrschte mich. Der Wahnsinn, der mich so oft bei Enteraktionen auf See befiel, verflog mehr und mehr und wich berechnender Ruhe. Ydane würde mir nicht auskommen, konnte sie auch später ins Gebet nehmen. Unsere Bäuerin hatte wohl auch genug, denn sie wollte nur noch hinaus, der versöhnliche Vorschlag Jackys, dass man nun doch erst recht zusammen baden gehen müsse, wurde nicht aufgegriffen und verhallte. Während Jacky noch die Wogen bei Ydane zu glätten suchte (dabei war die Landpomeranze selbst schuld..) tat sich selbiges bei Aron, denn ihm hatte ich nichts Böses gewollt, er war ein Kumpel, jemand, dem ich mein Leben an Land anvertrauen konnte. Es war nur gerecht, mit ihm neuen Frieden zu schließen – obwohl uns beiden klar war, dass es niemals Krieg zwischen uns gegeben hatte: Die Sache war in dem Moment vergessen, als wir unsere Waffen gesenkt hatten. Er äußerte sich nur noch einmal zu dem Umstand, dass ich doch wohl nicht auf Iri hätte schießen wollen, was jene leise, fast murmelnd (sie stand vor der Hintertür, den Kopf dagegen gelehnt, sichtlich resigniert) negierte, ich hätte niemals auf sie geschossen. Und damit hatte das Kindchen Recht, das hätte ich nicht, obwohl ich es vor wenigen Augenblicken noch in Kauf genommen hatte – oder es zumindest geglaubt hatte, in Kauf zu nehmen.
Verbrüdere dich nicht zu sehr mit Landratten, hallte es in meinem Kopf, doch ich wischte diese Erinnerung energisch mit einem Kopfschütteln hinfort. Das waren nicht nur Geschäftspartner, sondern mittlerweile Freunde. Landratte hin oder her.
Als ich mich zu Ydane und Jacky hinübergesellte – Iri und Aron begannen nämlich ohne Vorwarnung übel zu turteln, war wohl ihre Art, mit dem Schock fertig zu werden, das brauchte ich mir jetzt nicht anzutun – hob die Bäuerin ihren immer noch gezogenen Dolch. Innerlich schmunzelte ich fröhlich, denn es entwickelte sich so, wie es mir lieb war, sollte sie ruhig etwas zappeln, vielleicht lernte sie daraus, dass das Verbreiten von Halbwahrheiten ungesund sein konnte. Jacky war freilich die Diplomatin in Person und wollte unbedingt, dass wir uns wieder vertrugen. Doch weder Ydane noch ich legten im Moment besonderen Wert darauf, so dass wir in Fehde auseinander gingen. Zusammen mit der Bäuerin verabschiedeten sich auch die zwei Turteltauben.
Endlich war es nicht mehr so voll hier drin.
Wenig später lagen wir nebeneinander unter den Fellen und Decken, die unsere Bettstatt bildeten, wir hatten schnell wieder zueinander gefunden, war all das doch eigentlich nur ein großes Missverständnis gewesen und fast schon… lächerlich. Wenn man es sich recht überlegte.
Aneinander geschmiegt palaverten wir also über mehr oder weniger unwichtiges Zeug, bis Jacky mir eine Frage stellte, die mich aufhorchen ließ. Irgendwie wusste ich, dass mir daraus so manche Strapazen erwachsen würden, wenn ich sie beantwortete. Doch vor Jacky konnte ich noch nie etwas sonderlich gut verbergen, weswegen ich beschloss, ihr alles zu berichten, was ich darüber wusste, ehe der angenehmere Teil dieses Abends und der Nacht anbrechen würde.
„Lissy, was sind Thyren?“
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 10 März 2010 14:52 Titel: Episode 16 – Eine große Familie? Teil 1 Verfasst am: 10 März 2010 14:52 Titel: Episode 16 – Eine große Familie? Teil 1 |
|
|
Episode 16 – Eine große Familie? Teil 1: Von cholerischen Rahalern und Charmeuren
9. Lenzing 254
Im Rahaler Hafenviertel
Die Kälte kroch mir langsam in die Glieder.
Zwar war der Frühling schon im Anbruch befindlich, der Schnee und winterlich anmutende Kälte hatten jedoch immer noch ihre eisigen Klauen um das Land gelegt; für jemanden, der wie ich einige Nächte lang durchgemacht hat, noch dazu im Freien, keine angenehme Sache. In den letzten Tagen war ich viel unterwegs gewesen, entlang der Küsten, zu Fuß und mit meinem Kahn, um „Freunde“ zu besuchen. Wir, die Bruderschaft, hatten entlang der Küsten so manchen Sympathisanten, alten Kameraden oder Familienangehörige, die für uns arbeiteten oder uns Unterschlupf boten, wenn wir ihn brauchten. Da waren zum einen die besagten passiven Mitläufer, die uns Haus, Essen, Unterkunft oder Informationen gaben, um uns zu helfen, zum anderen hatten wir vor allem in den größeren Ansiedlungen und Handelsstandorten aktive Mitarbeiter sitzen – Agenten. Vom einfachen Straßenkriminellen, der sich ein paar Groschen dazu verdienen wollte, bis zum Spion aus höchsten bürgerlichen Kreisen, der sich aus den Machenschaften Vorteile für seine Karriere verhoffte, war da alles vertreten. Neben den Stützpunkten dieser Mitarbeiter waren da natürlich, ähnlich den Perlen auf einer Perlenkette aneinander gereiht die geheimen Schmuggellager und Treffpunkte der Bruderschaft, die es regelmäßig zu kontrollieren galt – auf Lagerbestand, sichere Lage, Einnahmen, Ausgaben, etwaiger Personalbedarf und so weiter.
Eben deswegen war ich auch unterwegs gewesen, schließlich musste die Rahaler Zelle der Bruderschaft auf Vordermann bleiben!
Jetzt, da die Pflicht getan war und ich mich auf dem Heimweg befand, überfiel mich die Müdigkeit, was auch kein Wunder war, angesichts des Umstands, dass ich kaum geschlafen hatte. Abgedroschen, matt und von der Kälte zur Eile angetrieben kam ich schließlich am Krähennest an und entriegelte die Tür, das übliche Prozedere: Aufschließen, Stiefel von Matsch und Schnee befreien, rasch hineinhuschen, ehe die Kälte allzu sehr in die Bude dringen konnte. Drinnen empfing mich eine sichtlich überraschte Jacky, der ich freilich, kaum, dass ich auf ihrer Höhe war, einen Begrüßungskuss gab – es war immer schwer, länger fern von ihr zu bleiben. Das würde in einigen Wochen, wenn wir wahrscheinlich wieder auf Kaperfahrt gehen würden – der ersten des neuen Jahres! – eine ziemliche Tortur werden. Die Überraschung in ihrem Gesicht wich rasch der reinen Freude, als wir uns in den Armen lagen und ich kam nicht umhin, erneut eine heimische Regung in mir zu verspüren. Einer dieser Momente, die man gerne ewig auskosten würde – doch alles musste einmal ein Ende haben, so auch jener Augenblick: Jacky eröffnete mir, dass während meiner Abwesenheit so einiges geschehen wäre (ich fand, dass ein milder Tadel in den Worten lag.. zu Recht, hatte ich ihr ja nicht mitgeteilt, dass ich eine Woche lang fortgehen würde) und sie begann ohne Umschweife, alles aufzuzählen. Jacky solle in den Kerker (mir klappte die Kinnlade bei der fulminanten Eröffnung herunter), es gäbe ein neues Mitglied bei den Elstern, Sperling und Jacky würden einen Coup in Düstersee planen und sie bräuchte obendrein meinen Rat. Hussa.. immer, wenn ich mal auf See war oder sonst wie verhindert, schaffte es meine Gefährtin, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Sie hatte offenbar gegen die Reit-Bestimmungen in der Stadt Rahal verstoßen, sei wohl zu schnell geritten und habe Passanten gefährdet, fürderhin sei ein Verstoß gegen das Waffengesetz für Gäste (wir hatten ja allesamt keinen Bürgerbrief) zu verzeichnen.
Ich konnte über die Vorwürfe nur den Kopf schütteln. Das große alatarische Reich (hier musste ich unweigerlich schmunzeln) ging schon merkwürdige Pfade. Sie hatten wegen der Pferde-Sache sogar Zettel verteilt, die auf „Jane Jack“ als Gesuchte hinwiesen! Taten so, als sei es ein Verbrechen gegen Alatar, dass sie es gewagt hatte, mit einem Pferd durch die Straßen zu reiten und womöglich irgendeinen hirnverbrannten Tölpel, der seine Augen nicht aufmachen konnte, halb über den Haufen geritten hatte. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe, die Stadtwache musste wahrhaft Langeweile haben. Als ob das nicht genug wäre, meinte sie ein Wachtmeister wegen des Diamantmessers, das ich ihr einmal geschenkt hatte, anzufeinden – wegen eines Messers, das Größe und Aufmachung nach eindeutig vor allem ein Arbeitsgerät war, keine Waffe. Wie hirnverbrannt waren diese rahalischen Soldaten eigentlich? Von ihrem fanatischen Glauben an „den Einen“ schon so verblödet, dass sie am Ende selbst den Metzgern der Stadt ihre Haumesser nahmen, weil das ja ein Verstoß gegen das Waffengesetz sei? Über solche Wichtigtuer, die vom Tuten und Blasen keine Ahnung hatten konnte und kann ich mich in Rage lästern! Mit einer der Gründe, weshalb ich meiner Familie und dem gutbürgerlichen Dahinsiechen geflohen bin… Wir kamen zu dem Schluss, dass Jacky sich nicht stellen würde. Im Hafenviertel hatten sie keinen langen Arm und wegen solch einer Lappalie würde niemand im Amt einen Aufstand machen – da wäre schon bald Gras darüber gewachsen.
Das einzige, was von den Neuigkeiten noch interessant für mich war, war der erwähnte Neuzugang.
Wie Jacky mir eröffnete war sein Name Sion Ann, der Bruder der Tavernen-Betreiberin in Berchgard und wäre ein äußerst charmanter, wohlerzogener junger Mann. Wohlerzogen, charmant, süß… beim Hut des Klabautermanns, ich hätte fast die Krise bekommen! Dieses Bild eines offensichtlichen Bürgerlichen, was mir ja nicht gerade gefiel, wurde allerdings etwas positiver, als offenbar wurde, dass der Junge diese Gesellschaft ebenso verabscheute, wie wir. Deswegen war er wohl auch für die Elstern von Interesse, laut Jacky im Besonderen für Iriel. Augenblicklich fühlte ich Mitleid mit Aron, denn mir schien gewiss zu sein, dass er bald seinen Fasan an den als Charmeur dargestellten Sion verlieren würde – diese zwei waren sich da ja sehr ähnlich. Würden sicher gut zusammen passen. Jacky bestätigte diese Gedanken auch sogleich, indem sie mich wissen ließ, dass Iriel mit Sion schon so ihre Pläne für Betrügereien hätte. Wollen wir nur hoffen, dass Aron es sportlich nahm – und nicht mörderisch, wie immer. Wäre besser für alle Beteiligten.
Wir kamen gerade auf die Thyren – die Tiefländer – zu sprechen, als es klopfte, leise, fast schon zaghaft.
Überrascht hatte ich zu Jacky geschaut, ob wir denn Besuch erwarten würden? Es war zwar noch nicht allzu spät, aber der Abend nahte. Mit Jackys Bitte im Gehör, doch nach dem Passwort zu fragen, ging ich zur Tür und spannte vorsorglich den Hahn meiner Pistole, die ich wie immer unter der Jacke bei mir trug – gegen Abend war das Hafenviertel immer ein unsicheres Pflaster, man konnte nicht vorsichtig genug sein. Ich fragte dne Eintrittswilligen nach der Losung, was er mit einer Adaption der Strophe eines Volkslieds beantwortete. Aha.. war wohl ein besoffener Spaßvogel auf dem Heimweg von der Kneipe, der sich in der Tür geirrt hatte! Doch Jacky negierte es, indem sie ausrief, dass das sicher Sion sei – also öffnete ich, nachdem ich den Pistolenhahn wieder entspannt hatte. Mit der Weisung, sich doch den Matsch von den Stiefeln zu klopfen, ließ ich den jungen Mann ein, der erst in unserer Bude seine Kapuze abnahm und so freien Blick auf sein Gesicht gewährte. Ein junges, unverbrauchtes (eindeutig gutbürgerliches) Gesicht, das man durchaus als schön bezeichnen konnte bot sich da meinen Blicken dar. Das war also Sion der Charmeur.

Er machte dieser Charakterstudie auch alle Ehren, indem er sich im Laufe des Aufenthalts stets mit äußerst charmeurösen Gesten an Jacky wandte, durch sein gepflegtes Äußeres, sein Gehabe. Er erinnerte mich ein wenig an mich selbst vor fünf oder sechs Jahren, als ich noch für die Tuchhandelsgesellschaft meines Onkels in der Handelsmarine fuhr – abgesehen von dem charmeurösen Gehabe, das lag mir nicht. Und ich mochte es so gar nicht an anderen Männern gegenüber meiner críde.
Als der Namen „Mandred“ fiel, wurde ich aus diesen missmutigen Gedanken gerissen – Mandred, der Adlerritter aus dem Orden der Temora. Dieser Mann war der Mentor Alessandro Marquez, des Ordensbruders, dieses verfluchten Mannes, mit dem ich noch eine Rechnung zu begleichen hatte! Es erfüllte mich mit unsäglicher Freude, dass sein Mentor laut Sion verschwunden zu sein schien. Wie vom Erdboden verschluckt.. ich hatte so meine Vermutungen, die ich aber nicht aussprach. Man würde unsere Informanten dazu befragen müssen.
Ich beschränkte mich für die nächste halbe Stunde auf den Genuss von Gewürzwein und Kraut, in dieser Zeit wurde Sion wohl über eine notwendige Zweigstelle des Bundes in Adoran informiert.. was auch immer, ich bekam es nur zur Hälfte mit. Nachdem der Krautstängel abgeraucht war, musste ich mich wohl oder übel wieder an der Konversation beteiligen, und das im rechten Moment: Man sprach von Analope Reuss, einer jungen Dame fraglichen Umgangs. Sie war Schneiderin und pflegte einen sehr offenen Lebenswandel, was Männer anging – jedenfalls hatte ich diesen Eindruck von ihr erhalten, als Jacky und ich vor langer Zeit einmal mit ihr unterwegs waren und dieses Fräulein mich hernach noch neu eingekleidet hat. Umsonst, wohl gemerkt. Bis heute war ich der Meinung, dass sie vorgehabt hatte, sich die Arbeit anderweitig begleichen zu lassen. Nun ja, wie dem auch sei: Sion war wohl ein Objekt ihres Interesses geworden und er schien gar nicht so unglücklich darüber zu sein. Was ich davon halten sollte, war mir zwar nicht ganz klar, aber was ging es mich auch an? Irgendwie war ich auch ganz froh darüber, dass dieser Charmeur vielleicht in die Fänge dieser Frau geriet und nicht mehr „frei“ war, dann konnte ich mit ruhigerem Gewissen zur See fahren.
Schließlich verabschiedete sich Sion von uns, er hatte noch einen Termin, der seiner harrte.
Das war also der Neue.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II
Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 10 März 2010 14:55, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 11 März 2010 19:12 Titel: Episode 16 - Eine große Familie? Teil 2 Verfasst am: 11 März 2010 19:12 Titel: Episode 16 - Eine große Familie? Teil 2 |
|
|
Episode 16 – Eine große Familie? Teil 2: Geschwisterliebe mal anders
9. Lenzing 254
Im Rahaler Hafenviertel und in Adoran
Nachdem Sion gegangen war, wollte ich mit Jacky den Abend mit einem Essen im berchgarder Lamm beenden. Man hörte ja immer wieder von dieser Taverne und langsam wurde es Zeit, dass ich mir einmal selbst ein Bild von der Einrichtung machte, meine Gefährtin riet aber davon ab. Dort würden sich die Frauen sowieso nur ständig angiften oder Klatsch verzapfen oder über die vermeintliche Untreue ihrer Männer lamentieren – spannend war etwas anderes, das stand fest. Doch konnte es wirklich so schlimm sein? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Indes war das nicht unser Hauptproblem, sondern der Umstand, dass unsereins dort nicht unbedingt hineinpassen würde. Unsereins.. damit meinte Jacky Menschen, die nicht in Kleidung nach dem neuesten Stil, aus Seide oder anderen sündhaft teuren Stoffen gehüllt waren. Dass ich nicht lache! Als ob so eine Taverne nur die Gepuderten einließe. Wie dem auch sei: Ordentliche Kleidung hatten wir beide, für besondere Anlässe erschlichen, ergaunert, „geliehen“ oder wie man es auch immer nennen wollte. Fehlte nur die Anpassung des Äußeren: Die Haare ordentlich gewaschen, gebadet, Hände und Fingernägel auf Hochglanz gebracht… dieser ganze Krampf, den ich von meinem Onkel während meiner Kaufmannslehre eingebläut bekommen hatte und zu einem guten Teil sogar noch jetzt regelmäßig durchführte. Mal abgesehen von den Händen und Fingernägeln.. das war... nicht meins. Zuerst dachten wir daran, uns eins unserer Lagerfässer zu nehmen, es auszuräumen und Wasser hineinzufüllen, um uns dann gegenseitig den Rücken zu schrubben und zu baden. Auch unsereins konnte sich ein privates Bad leisten, aye! Freilich kam es nicht dazu, denn die Fässer waren allesamt undicht und ich hatte kein Werg mehr im Haus, um sie abzudichten. So beschlossen wir, einen Abstecher nach Bajard zu machen, vielleicht würde man dort ja bei einem Küfer einen billigen Restbestand erstehen können.

In Bajard angekommen stellte sich rasch heraus, dass wir nicht fündig werden würden, weswegen wir schon vor der Hinreise einen anderen (Ausweich)Beschluss gefasst hatten, dessen positives Ergebnis mich immer noch wunderte: Wir wollten ins adoraner Badehaus gehen und die so badehausscheue Jacky stimmte sogar zu! Also ging es nun von Bajard direkt weiter nach Adoran.
Nachdem wir die Tore hinter uns gelassen hatten, machten wir noch einen kleinen Abstecher zu der Prangerinsel, die mitten im Wassergraben der adoraner Befestigung angelegt war: Von dort hatten mein Maat Gracia und ich Kimroth in einer waghalsigen Nacht- und Nebelaktion befreit, diesen Ort des Triumphs für unser Pack und der Schande für die adoraner Stadtwache wollte ich Jacky nicht vorenthalten, wenn wir schon hier waren.
Hernach ging es direkt weiter, an der Brücke war wie so oft ein weiterer Posten der Wache aufgestellt, um die meist eher nachlässigen Zollkontrollen am Tor zu überprüfen. Und verdächtige Reisende spätestens dort abzufangen. Glücklicherweise war er Soldat mit einem Reiter beschäftigt, so dass wir unbehelligt vorbei schlendern konnten und unserer Wege gingen – oder gehen wollten. Denn kaum, dass wir die Brücke verlassen hatten, hörte ich scheppernde Laufschritte hinter uns näher kommen. Ein Seufzen entrang sich meinem Munde, als ich über die Schulter zurückblickte und meine Befürchtungen bestätigt sah: Der Wachposten hatte uns gesehen und wollte uns auch überprüfen. Scheiß Bürokraten! Als der Wachposten zu uns aufgeholt hatte blieben wir stehen, um uns in das Unausweichliche zu fügen, doch es kam anders. Der Soldat blieb wie angewurzelt stehen, als ich mich ihm zugewandt hatte und stierte mich an, als sei ich aus den Fängen des Seelenfressers entflohen. Als er meinen Namen leise, nahezu ungläubig aussprach (wohl gemerkt meinen echten), begann ich ihn irritiert zu mustern, Jacky rief ihn als „Ilbert“ an, da traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag ins Gesicht. Ich wich wild gestikulierend zurück und rief erschrocken aus: HIMMEL!
Mir war das Gesicht ja gleich so bekannt vorgekommen!
Ilbert war mein Halbbruder. Wir hatten denselben Vater, nur die Mütter waren verschieden – meine war bei meiner Geburt verstorben, so dass mein alter Herr sich bald eine neue Frau genommen hatte. Ilberts Mutter.
Als erstgeborener Sohn hatte mich unser Vater unbewusst oder bewusst stets bevorzugt. Ich war es, der von einem Hauslehrer Lesen, Schreiben, Rechnen und die Götterlehren nähergebracht bekam, ich war es, der zur Kaufmannslehre zu meinem Onkel geschickt wurde. Und, was wohl am schwersten für meinen kleinen Bruder wog, ich war es, der die Hochachtung und den Lob des Vaters abbekam. Ilbert spielte damals immer die zweite Geige und es hatte ihn zunehmend verbittert – Streit zwischen uns war an der Tagesordnung gewesen, der ebenso nahezu immer in blutigen Schlägereien endete. Wir schenkten uns nichts in diesen Jugendtagen. Als ich meine Kaufmannslehre abgeschlossen und zur See gefahren war, hatte sich nicht viel daran geändert; und schließlich war ich es gewesen, der bevorzugte, gut ausgebildete und erbberechtigte Erstgeborene, der seine Familie, seinen Vater den Rücken zugekehrt hatte und den eigenen Tod auf See vorgetäuscht hatte. Irgendwie konnte ich es Ilbert nicht verübeln, wenn er jetzt noch sauer auf mich war.
Ein kräftiger, unerwartet kommender Hieb in meine Magengrube bewies mir auf unangenehme Art, dass er in der Tat noch sauer auf mich war! Mir wurde kurzzeitig schwarz vor den Augen, als ich hustend und Galle spuckend auf ein Knie vornüber sank und mir den Bauch hielt. Der hatte gesessen! Da wallte der alte Zorn in mir auf, den wir beide so lange und fleißig in unseren Herzen geschürt hatten, Zorn und Hass.
„Freut mick ouch, dick zou seh’n.“ Diese Worte unterlegte ich mit öligem Sarkasmus, erstes Anzeichen des aufkeimenden Grolls, den ich unter einem selbstgefälligen, ja überheblichen, Lächeln verbarg. Die Frage Ilberts, warum ich denn nicht geschrieben hätte, wenn ich doch noch am Leben sei beantwortete ich wahrheitsgemäß: Ich war davon ausgegangen, dass der Rest der Familie zusammen mit meinem Onkel in Varuna gestorben wäre, bei dem großen Brand.. und ohnehin hatte ich nicht vorgehabt, mich zu melden.. was glaubte er denn? Nach einem milden Stoß gegen seinen Oberkörper, herausfordernd, ging er darauf sogleich ein und stürmte auf mich los. Diesmal war ich vorbereitet und wich ihm zur Seite aus, dass er ins Leere rannte. Sichtlich um Fassung bemüht spie er mir entgegen, dass unser Vater, unsere Familie sehr wohl noch am Leben war und mir entging nicht die scharfe Spitze seiner Worte, als er sie als „meine Familie“ bezeichnete, nicht unsere. Das ewige Hin und Her an Schmähungen und Beschimpfungen ging so fort, bis wieder eine Grenze überschritten war und die Fäuste sprachen. Dieses Mal gelang es mir, meinen Bruder zu erwischen – am Kinn. Damit waren wir für den Abend quitt.
Es war wohl eher Jackys Anwesenheit und den nahen Brückenwachen zu verdanken, dass wir uns nicht in einer heillosen Keilerei gegenseitig blutig schlugen, denn wir schafften es stattdessen irgendwie, halbwegs friedlich unserer Wege zu gehen. Nun, da bald meine ganze Familie wissen würde, dass ich noch am Leben war, müsste ich umso vorsichtiger sein. Auch wenn ich dieser gutbürgerlichen Welt geflohen war, wollte ich nicht, dass mein Vater erfuhr, was ich nun tat, auch wenn ich es aus vollem Herzen verfolgte: Die Piraterie.
Ilbert hatte mir an diesem Abend durch sein Verhalten, seine Worte klar gemacht, das der Alte seinem erstgeborenen Sohn immer noch nachtrauerte – deswegen auch der ungebrochene Zorn meines kleinen Bruders auf mich. Ich teilte ihn, freilich, denn der Junge war einfach ein impertinenter, kleiner Bastard, der niemals Ruhe geben konnte. Bruder hin oder her. Das konnte noch heiter werden…
Nach dieser überraschenden Unterbrechung kamen wir, nun wieder zu zweit, endlich am Badehaus an, das direkt neben dem Gefängnis lag – ein interessantes Detail. Entgegen Jackys Befürchtungen war es leer, was zu der fortgeschrittenen Abendstunde kein Wunder war. Ein paar einführende Worte (sie war nämlich noch nie in so einem Haus gewesen) begaben wir uns in die Umkleidekabinen, um uns umzuziehen. Fürs Erste beließ ich es bei einer alten, abgetragenen kurzen Hose, um dem Sittengesetz des Reiches gerecht zu werden und führte Jacky, die sich in einen äußerst kurzen Rock (so kurz, dass er den Namen kaum mehr verdiente, wie ich mir mit anzüglichem Schmunzeln eingestand) und eins dieser hauchdünnen Oberteile gekleidet hatte, in den Hauptbaderaum. Hier gab es nicht nur eine fließende Quelle, sondern auch das große Warmwasserbecken, der Bereich in den Badehäusern, der mir am meisten taugte – neben den Saunen, versteht sich. So sehr ich auch froh war, dem gutbürgerlichen Leben meiner Familie entflohen zu sein, war die Badekultur etwas, das ich trotz allem weiterhin schätze und so oft es ging auch ausübte. Zielgerichtet ging es also zu der fließenden Quelle, wo ich eine der bereitliegenden großen Schöpfkellen ergriff und mich daran machte, mich kräftig mit Wasser zu übergießen. Diese Praxis sah ich heutzutage immer seltener, aber ich hatte sie noch von meinem Onkel übernommen (eines der wenigen guten Dinge, die er mir hinterließ): Zuerst wusch man sich an dieser Quelle ordentlich mit Seife und wahlweise auch Ölen, ehe man in das Hauptbecken stieg und dort die Zeit zur Entspannung nutzte. Allzu viele interessieren sich heute dafür nicht mehr und gehen mitsamt Seifen und dreckig in das Hauptbecken, um sich dort zu waschen. Eine schreckliche Unsitte, bei der sogar ich spießig werden konnte.
Jacky schloss sich nach etwas Zögern meiner Vorgehensweise an, seifte sich sogar mit einem Cocktail aus mehreren Seifen ein und stieg dann, schneller fertig als ich, zuerst ins Warmwasserbecken hinein. Während ich mir noch ein Handtuch bereitlegte und mich meiner Hose entledigte, folgte ich ihr mit musternden Blicken – sie war immer eine Augenweide, besonders in solchen Momenten… und ich war froh, dass wir alleine waren. Dann musste ich keine Gaffer ertragen.
Als ich mich im Becken dazu gesellt hatte, schwamm ich einige Züge, von einem Beckenende zum anderen, bis wir uns auf gegenseitiges Untertauchen, Unterwasserziehen und Liebkosungen beschränkten. Kurzum: Eine angenehme Zeit zu zweit, die allzu früh enden musste, jedenfalls, wenn es nach mir ging.
Aber was sollte man machen… bald würde das Badehaus geschlossen werden, also zogen wir uns wieder an, ließen einen Obolus aus einigen Kupferlingen am Tresen zurück und gingen unserer Wege. Heim in unser Krähennest.
Schlaf fand ich diese Nacht allerdings kaum. Erinnerungen an früher, an meine Familie, hielten mich bis kurz vor Sonnenaufgang wach.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II
Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 11 März 2010 19:12, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 26 März 2010 15:19 Titel: Episode 17 – Das Problem mit den Blauhäuten Verfasst am: 26 März 2010 15:19 Titel: Episode 17 – Das Problem mit den Blauhäuten |
|
|
Episode 17 – Das Problem mit den Blauhäuten
25. Lenzing 253
Im Rahaler Hafenviertel
Die Seebeben und das drohende Grollen des Vulkans auf La Cabeza hatten in den letzten Wochen an Häufigkeit und Intensität zugenommen. Im Schweiße unseres Angesichts hatten wir die Schiffe in Windeseile seetauglich gemacht, um mit Mann und Maus, Schätzen und Munition die Insel zu verlassen und vorübergehend andere Gestade anzulaufen. Die älteren Piraten wussten über das, was kommen würde, zu erzählen: Die Insel war nämlich, so heißt es und wurde es von den vorherigen Einwohnern, einem indianischen Stamm, überliefert, von diesem Vulkan ins Meer gespeiht. Und was ein Vulkan gab, konnte er auch wieder nehmen. Oder so ähnlich. Jedenfalls war die Aussicht auf Lavaergüsse, Erdbeben, die den Boden aufzureißen drohten und Sturmfluten ausreichend, um selbst den hartgesottensten Seebären davon zu überzeugen, dass die Order Pereras, die Insel zu verlassen klug und der Gesundheit zum Vorteil wäre.
Die kleine Flottille, angeführt von unserem Flaggschiff „Toro de Muerte“, hatte sich bei Lameriast einen zwischenzeitlichen, sicheren Hafen gesucht. Als die Lage geklärt, die Anker ausgeworfen und die Wachen eingeteilt waren, konnte ich endlich wieder etwas Zeit frei schinden, um nach meiner Gefährtin zu sehen. Per Kahn ging es hierzu nach Rahal, was dank des zunehmend wieder besser schiffbaren Küstengewässers weit schneller von statten ging, als in den tiefsten Wintermonaten zuvor.
In Rahal angekommen fand ich die Spelunke von Kim wie gewohnt gefüllt mit Lärm, Gästen, Alkohol und mildem Licht, doch den Impuls, hineinzugehen und einen Humpen zu heben kämpfte ich nieder. Zielstrebig ging es zum Krähennest, das ich jedoch leer vorfand. Es war früher Nachmittag, kaum ein Glasen nach Mittag. Sie würde beim Angeln sein. Also beschloss ich, es mir am Kamin gemütlich zu machen und meine Muskete auf Vordermann zu bringen, die bei den Übungsmanövern im feuchten Meeresklima Flugrost an Lauf und Schloss angesetzt hatte. Gerade, als ich den Ladestock mit einem Lappen am vorderen Ende präpariert hatte und in den Lauf stieß, um Pulver- und Bleirückstände damit von den Laufinnenwänden abzureiben, ging die Tür zum Hinterhof neben mir auf. Herein trat meine Gefährtin, Jacky, die mich der Tür wegen, zuerst nicht bemerkte. Einen ausgetauschten Gruß und Begrüßungsküsse später hatte sie bereits die Position der Muskete eingenommen und saß auf meinem Schoß, als wir uns in den Armen lagen. Mochten die Landratten von uns Piraten denken, was sie wollten, die geliebte Gefährtin nach Wochen wieder zu sehen, ließ auch den gewieftesten Seebären schwach werden.
Nur irgendetwas war diesmal anders. Etwas, dass sich wie Stofffetzen anfühlte und einen leicht miefenden Geruch an sich hatte. Mein Blick glitt an Jacks rechten Oberarm hinab und tatsächlich: Dort der bare Arm war provisorisch einbandagiert und die Stofffetzen, die als Bindenersatz herhielten, von einer modrigen Flüssigkeit durchsetzt. Noch ehe ich der sich auf meinen Gesichtszügen bildenden Überraschung Ausdruck geben konnte, war Jacky von meinem Schoß geglitten und hinüber zum Kamin gegangen, um Gewürzwein aufzusetzen. Auf die Frage, was mit ihrem Arm passiert wäre, antwortete sie zuerst ausweichend und wie beiläufig, dass es eine lange Geschichte sei. Das tat sie gerne. Nur, dass sie diesmal vollauf Recht hatte: Es war lange her, dass ich bei ihr gewesen war, fast drei Wochen.
Ein Lethar hatte den Schlüssel zu unserer Hütte eingefordert, da ich eine Abmachung nicht eingehalten hätte. Jacky, die sich natürlich sträubte, ihm zu entsprechen, hatte es dann mit seinem Schwert zu tun bekommen und nur mit Glück hatte sie einen fürchterlichen Streich davon überstanden: An der Hafenmole war es gewesen, wohin der Lethar sie gedrängt hatte und als sie dem Hieb auszuweichen versuchte war sie die Mole hinab ins Wasser gefallen – das Schwert hatte sich nur noch in ihren rechten Oberarm fressen können. Danach war sie mit Mühe und Not, halb ersoffen, unter Wasser entkommen. Der schwertschwingende Lethar war für mich kein Unbekannter – als sie den Namen nannte, hatte ich ihn schon längst im Geiste geformt; Ix’ylor. Ich hatte insgeheim gehofft, die Abmachung mit dem Letharen nicht einhalten zu müssen, dass gras darüber wachsen würde, wenn ich erst einmal wieder eine Zeit lang auf See gewesen wäre, doch dem war offenkundig nicht so. Nach den Nachforschungen und dem bösen Spiel, das Vallas und ich mit Ix’ylor betrieben hatten, war er uns spinnefeind geworden. Mehr durch Zufall hatte er mich später angetroffen und mich vor die Wahl gestellt: Entweder ich brächte ihm einen einflussreichen Adoraner oder unsere Hütte mit allem, sowohl Einrichtung, als auch Bewohnern, würde ihm zum Opfer fallen. Niemals hatte ich damit gerechnet, dass er aus dieser Drohung Ernst machen würde, doch nun saß ich da und sah die grässliche Schnittwunde an Jackys Arm. Dabei hatte sie damit doch nichts zu tun! Verdammte Mistschweine von blauhäutigen Langohren! Vor kaum zwanzig Jahren waren sie noch Sklaven der rahaler Menschen gewesen und nun bildeten sie sich darauf, die Kinder Alatars zu sein, etwas ein. Und redliche Piraten wie ich, die sich mit ehrlicher Plünderung und Schmuggel ihr Brot verdienten, hatten darunter zu leiden.
Jacky hatte, wie sich herausstellte, zwei Burschen zu verdanken, noch gesund hier zu sitzen, Vinory und Miremar hießen sie, die sich um die behelfsmäßige Versorgung ihrer Wunde bemüht hatten. Wenn ich die Männer antraf, nahm ich mir vor, ihnen meinen Dank auszusprechen. Das sollte schneller kommen, als gedacht.
Zu meinem Leidwesen war der dunkle, miefende Sud an den Bandagen deutliches Anzeichen für den_Sumpf: In der Tat erzählte mir Jacky fröhlich davon, dass sie in den Sumpf gegangen wäre und mit ihren zwei Rettern die Zeremonie durchgeführt hätte, die sie schon mit mir einmal vollzogen hatte (Siehe Episode 2). Da wurde der Hund in der Pfanne verrückt! Mir wäre danach mein Fuß halb abgefault und nun probierte sie dieses irrwitzige Zeug an sich selbst noch einmal aus?!
Den Tadel mit der Äußerung revidierend, dass es nur bei Frauen funktioniere, ging sie hinüber zum Badezuber auf der anderen Seite der Bude, bat mich, ihr behilflich zu sein. Seufzend gab ich nach, es hatte ja doch keinen Sinn.
Während sich Jacky auszog und in den Zuber, der schon mit heißem Wasser gefüllt war stieg, richtete ich Seifen, Fläschchen mit undefinierbaren Mitteln darin, Handtücher und Bürsten her. Jacky hatte ein Badehaus in Kleinstausführung eingerichtet. Man brauchte nur ein dichtes Fass, Wasser, Seifen und ein wenig Fantasie. Meine Gefährtin hatte sich an den Zuberrand gelehnt, während ich sie einzuseifen begann und dabei tunlichst darauf achtete, dass sie die Wunde außerhalb des Wassers ließ. Ausgiebiges Rückenschrubben später schien sie beschlossen zu haben, dass ich zu sehr nach Meersalz und Schifffahrt roch oder was auch immer, jedenfalls wandte sie sich im Fass herum und wollte mich unvermittelt mit Wort und Tat hereinziehen. Da schwappte und platschte es nur so von überlaufendem Wasser und Schaum und die trübe Besorgnis entglitt meinen Zügen, wich etwas anderem. Es war ja nun schon allzu lange her…
Fix hatte ich mich der Kleidung entledigt und war dazu gestiegen, bewies jedoch die Disziplin, mich zuerst selbst an Leib und Haupthaar einzuseifen und zu waschen – denn nötig hatte ich es wirklich. Gerade schrubbte ich mir den Bart und trachtete…. Da klopfte es an der rückwärtigen, zum Innenhof gewandten Türe.
Scheiße.
Wiederwillig vor mich hin brummelnd stieg ich aus dem Zuber und suchte rasch nach meiner Kleidung, indem ich rufend um einen Moment bat. Mit der Weisung im Ohr, doch nach der Losung zu fragen, ging ich dann zu Türe – barfuß, nur provisorisch mit einem Handtuch trockengerieben, das Hemd noch nicht einmal zugeknöpft. Was Jacky immer mit ihren Losungen hatte… nun ja, ich fragte danach und erhielt die mir bereits vertraute Art von Antwort: Für mich wie blanker Blödsinn klingendes Zeug. Es schien Jack allerdings zufrieden zu stellen, also öffnete ich und fand einen Mann in merkwürdiger Kleidung vor. Am markantesten war der Narrenhut. Ein Gaukler?
Nichts dergleichen. Es war einer der Männer, denen ich Jackys gesunden Verbleib zu verdanken hatte; Miremar der Schneider, den sie kurzum auch noch für die Elstern geworben hatte. Während ich mir die nassen Haare mit dem Handtuch trocken wrang und das Hemd zuknöpfte war Jacky, sich abgetrocknet und angezogen, dazu gekommen und hatte Miremar einen Platz bei dem Wust an Fellen und Kissen angeboten. Ich beschloss, mich wieder um meine Muskete zu kümmern, wenn schon Besuch da war, konnte man die Zeit so am besten totschlagen. Während ich fortfuhr, den lauf zu säubern, hatte Miremar von Jack Gewürzwein erhalten und Anstalten gemacht, ihn abzuweisen. In saloppen, direkten Worten hatte ich ihn darauf hingewiesen, dass der Wein gut sei und er ihn ruhig trinken könnte, was mir eine Bezichtigung von Jacky einhandelte, grob zu sein. Ich und grob, tz… was konnte ich dafür, dass der Knilch keinen Alkohol gewöhnt war? Da wurde es Zeit, dass er es wurde. Der Schneider nippte auch vom Gewürzwein, doch seine Aufmerksamkeit hatte sich seinem Blick nach zu urteilen auf meine Muskete umgepolt – jedenfalls verzog er nicht wirklich eine Miene zum Wein, was mich darin bestärkte. Jedem anderen Abstinenzler hätte man es im Gesicht angesehen. Nun ja, es war ihm nicht zu verübeln, unsere Feuerrohre, die an Land gerne „Drachenohre“ genannt wurden, hatten unter den Landratten einen legendären Ruf, wenn sie überhaupt einmal von ihnen gehört hatten. Meistens dachte man bei ihnen an eine Art Magie. War natürlich alles lächerlich, aber wir wären die letzten, die diese Mären zerstreuen würden – sie machten es uns leichter, unserem Tagewerk nachzugehen. Es war besser, durch die Furcht des Opfers vor dem Ungewissen zu siegen, als wirklich abdrücken zu müssen. Das milde Amüsement, das sich in mir breitmachte, versuchte ich mir nicht anmerken zu lassen, während ich die Muskete weiter reinigte, gerade daran, das Schloss zu bearbeiten. Sollte er doch gaffen, war ja harmlos, außerdem hatte er Jacky geholfen. Wieso also misstrauisch sein?
Als Jacky den matschig-verkrusteten Verband von ihrem Arm löste, gab es indes Grund genug, misstrauisch, ja besorgt zu werden. Die Wunde sah schrecklich aus: Dreck aus dem Sumpf war in jedes noch so kleine Eck der Wunde gedrungen, an mehreren Stellen schwärte sie und ich vermochte, als ich rasch zu Jacky hinübergetreten und die Wunde ins Auge gefasst hatte, auch wildes Fleisch am zu erkennen. Weißgott, ich war kein Wundarzt, aber so etwas hatte ich an Bord schon oft genug gesehen: Die Wunde war eindeutig entzündet und schwärte. Ein kurzes Riechen an ihr bestätigte dies: Allerhöchste Zeit. Zu dem Stadthalter und Heilkundigen Stranamorius konnten wir nicht gehen, für Jacky war das zu riskant. Also mussten wir einen anderen Weg finden, den sah ich im Blitzpulver. Bevor ich zu einem diesbezüglichen Vorschlag ansetzen konnte, klopfte es erneut. Wie sich zeigte, war es Vinory, der Söldner, zweiter Mann im Bunde derer, die sich um Jacky gekümmert hatten. Endlich sprach ich den Dank aus, den ich ihnen beiden dafür schuldete, doch für mehr war keine Zeit, es musste etwas getan werden.
Kaum, dass Jacky davon erfahren hatte, dass die Wunde erneut gesäubert werden müsse, und zwar mit Pulver, war sie auf die andere Raumseite entwichen. Das Dreinreden von Miremar, der beipflichtend die Gefahr einer Amputation heraufbeschwor, wenn es zu sehr schwären würde, machte es nicht besser. Doch klare Worte mussten gesprochen werden: Manch einem Kameraden war schon das Bein nach einer Hiebwunde bei einem Entermanöver abgefault, oder der Wundbrand hatte ihn dahingerafft, nur weil wir nicht rechtzeitig die Entzündung erkannt hatten. Irgendwann hatte ein Kamerad eine Methode entwickelt, die gute Erfolge erzielte, zumindest, bis man es zu einem Wundarzt schaffte. Diese Errungenschaft wollte ich nun erstmals an Land ausprobieren.
Jacky, die sich ihrem Schicksal und dem guten Zureden von uns dreien gebeugt hatte, willigte ein, so dass es als nächstes direkt zu Miremars Schneiderladen im Norden es Hafenviertels ging: Dort hatten wir ein saubereres Umfeld, als im Krähennest und Miremar seine Nähutensilien.
Im Laden angekommen bereitete man eine Matte nahe dem Kamin mitsamt Bandagen, Tüchern und was sonst so notwendig werden könnte, während Jacky sich mit mitgebrachtem Rum zulaufen ließ und ich mir einen Krautstängel im Schnelldurchgang in die Lungen hinab zog. Aufregung machte sich in mir breit, die ich dadurch zu besänftigen trachtete. Nicht, dass es das erste Mal gewesen wäre, dass ich diese Prozedur durchführte, aber es war immerhin meine Gefährtin, meine críde, um die es hier ging. Nachdem ich mir einen neuen Krautstängel angezündet hatte und Jacky auf der Matte saß – sie bestand darauf, zu sitzen, denn sie wolle „im sitzen sterben“, wenn es denn so weit käme... blanker Blödsinn, der Alkohol musste schon aus ihr sprechen – gingen wir in Position. Miremar befand sich schräg neben mir, um den lädierten Arm zu halten, Vin befand sich hinter Jacky, um sie fest gepackt zu halten, denn es war zu erwarten, dass sie im Verlauf der Prozedur ohnmächtig werden würde. Ich für meinen Teil kniete mich vor ihr hin und überprüfte die Funktionalität der Pulverflasche, begleitet von beruhigenden Worten zu Jacky, die trotz des Alkohols noch ziemlich aufgedreht schien. Mittels des Daumens verschloss ich die Öffnung der Eichtülle am vorderen Ende der Pulverflasche und ließ eine Eichmenge Pulver hinein fließen. An der Daumenkuppe vorbei ließ ich dann sorgfältig und in dünnen Bahnen das Blitzpulver auf Jackys Wunde hinab rieseln, von einem Wundende zum anderen. Dank Vins, Miremars und meines festen Griffs konnte Jacky das heftige Zucken, das nun folgte, nicht in vollem Umfang ausführen – ein gleichmäßiges verteilen des Pulvers war dadurch möglich. Erst, nachdem die ganze Wundfläche gleichmäßig mit einer dünnen Schicht Pulver bedeckt war, nahm ich eine zweite Eichmenge, von der ein Teil auf besonders auffallende Wundareale aufgebracht wurde. Erst, als ich die Pulverflasche zur Seite stellte und mir ein knapp an der Öffnung vorbeirieselnder glimmender Ascherest auffiel, wurde mir gewahr, dass ich wieder einmal einer Gewohnheit folgte, die mir an Bord so manches Mal Ärger eingehandelt hatte: Während ich mit offen herumliegendem Pulver hantierte, rauchte ich Kraut. Blanker Irrsinn. Aber was soll’s... ich brauchte das Feuer sowieso, also nahm ich den Glimmstängel aus dem Mund und sprach warnend zu Jacky, dass es nun schmerzhaft werden könnte. Dann drückte ich das glimmende Ende des Krautstängels auf die feine Pulverschicht auf der Wunde.
Zitsch! Peng!
Da flogen Funken, wölbte sich eine kleine dichte Wolke Pulverrauchs über der Wunde empor – und Jacky schrie. Wir waren vorbereitet und so packte Vinory fester zu, hielt Miremar den Arm in waagrechter Position, während sich Jacky am Nacken fasste und meine Stirn an die ihre legte. Jetzt heiß es, sie so lange zu ruhig zu halten, bis das abbrennende Pulver das wilde und schwärende Fleisch fortgebrannt hatte. Reine Erfahrungswerte, die zugegeben mit etwas Glück zu tun hatten. Doch das schlimmste sollte noch auf meine Geliebte zukommen.
Ich nahm ihr die Rumflasche ab und kippte einen guten Schuss davon auf die immer noch zischelnde und wütende Wunde, so dass ein lautes Verpuffen vernehmbar war, gepaart mit einem lauten Aufschreien Jackys, die kurzerhand in Ohnmacht fiel. Mit einem der bereitliegenden Tücher erstickte ich den letzten Hitzerest in der Wunde, nun war es an der Zeit, dass Miremar seines Amtes waltete. Vinory und ich legten die bewusstlose Jacky auf der Matte ausgestreckt hin und machten Miremar, der mit Nadeln und Faden gewappnet wieder kam, Platz. Zumindest so weit, dass er hantieren konnte und ich Jackys gesunde Hand halten konnte. So, wie die Wunde aussah, war die Prozedur geglückt. Nun musste Miremar zeigen, dass ein Schneider im Notfall auch Haut statt Stoff nähen konnte.
Ein ungehobelter, rothaariger Säufer mit einem gewaltigen Vollbart war mittlerweile hinzugekommen und es schien, als würden er und die beiden Männer sich kennen. Mir war er nur insoweit aufgefallen, weil er nicht nur laut polternd angekommen war, sondern mir Schnaps anbieten konnte. Den brauchte ich nämlich nun wahrhaftig, nach der Aufregung.
Noch während Miremar die Wunde vernähte ergriff mich ein Unwohlsein in meinem Innern, das ich allzu gut kannte. Der Ruf.
Aberglaube oder nicht, für mich war er sehr real, seit ich meine Unterschrift im Mannschafts- und Soldbuch der Toro abgegeben hatte, mich 10 Jahre an Schiff und Käptn zu binden. Seitdem war dieses Gefühl von Unwohlsein, dem Drang in die Ferne, impertinent geworden, wenn es auftrat – wie heute. Mir blieb dabei nichts anderes, als ihm irgendwann nachzugeben, wenn ich nicht den Verstand verlieren wollte.
Glücklicherweise hatte Miremar gerade die Wunde fertig vernäht und Vinory in Windeseile einen neuen Verband angebracht. Die mittlerweile wieder zu sich gekommene Jacky, geschwächt und bleich, wollte unbedingt in die eigenen vier Wände, so dass wir zusammen abzogen, Dank und Verabschiedung aussprechend.
Zu Hause angekommen ließ sie sich auf einem Hocker nahe dem Kamin nieder, während ich direkt meine Muskete holte und im Lederfutteral verstaute. Es war Zeit. Munitionstasche, Werkzeugtasche und sämtlicher anderer notwendiger Kram wurden rasch überprüft und umgehängt oder in die Tasche gestopft. Jacky blieb das geschäftige Treiben trotz ihres geschwächten Zustands nicht verborgen und so fragte sie mich, ob ich fort wolle. Da sank mir der Mut. Ich hätte es vorgezogen, in aller Stille, in der Nacht oder so, abzuziehen, doch der Ruf war so dringlich gewesen, dass mir die Zeit dazu nicht bleiben würde. Außerdem hatte ich Jacky vor längerem versprechen müssen, nie wortlos auf See zu gehen, ich hatte also keine andere Wahl, denn Versprechen ihr gegenüber wollte ich einhalten.
Sie schien wenig erfreut darüber zu sein, als ich ihr eröffnete, dass ich zurück an Bord müsse, sie drehte mir sogar demonstrativ den Rücken zu. Ich stierte einen Moment lang auf den mir gezeigten Rücken und wollte schon, hin und her gerissen zwischen dem Drang, in die Ferne zu ziehen und diesem zu widerstehen, losgehen, als sie sich mir wieder zuwandte. Und lächelte. Das waren die Momente, in denen ich wusste, warum ich mich für diese Kleingaunerin entschieden hatte, sie war nicht so kompliziert, wie die Damen, die ich in meinem früheren Leben kennengelernt hatte. Sie konnte Verständnis zeigen.
Ich gab ihr einen langen Abschiedskuss und machte mich auf den Weg.
Zurück zur Toro de Muerte.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 18 Apr 2010 15:33 Titel: Episode 18 - Familie und andere Absonderlichkeiten Verfasst am: 18 Apr 2010 15:33 Titel: Episode 18 - Familie und andere Absonderlichkeiten |
|
|
Episode 18 – Familie und andere Absonderlichkeiten
17. Wechselwind 253
Im Rahaler Hafenviertel und nördlich von Adoran
Schon am frühen Morgen dieses Tages verließ ich unser gemeinsames Nachtlager.
Vor einigen Tagen war ich erst wieder zu Jacky heimgekehrt und hatte feststellen müssen, dass der Ruf der See einmal mehr bewies, zugleich Befreiung, als auch Fluch zu sein: Meine Gefährtin hatte sich im Zuge eines Zusammenstoß mit einem Letharen namens Ix’ylor den rechten Arm verletzt – ein tiefer Schnitt am Oberarm, der nur mittelmäßig versorgt worden war und bald zu schwären begonnen hatte. Zu dritt – Miremar, der Schneider und Vinory, der Söldner, wie auch ich selbst – hatten wir die Wunde zwar schließlich zu säubern und vernähen gemocht, doch die rabiaten Mittel ließen mich im Nachhinein leise schauern. Nicht, dass ich in solchen Dingen zart besaitet gewesen wäre.. Blitzpulver in der Wunde war dem Alkohol oder ähnlichem um Längen überlegen, was die Beseitigung von wildem Fleisch anging, doch meine Liebste vor Schmerz aufschreien und sich winden zu sehen war trotz allem harter Tobak. Weit mehr noch der Umstand, sie kurz darauf wieder verlassen zu müssen, um dem Ruf zu folgen.
Als ich Wochen später wieder daheim war, war der Arm verheilt und Jacky in voller Gesundheit – zum Glück. Der Fluch der Verwundeten, namentlich Wundbrand, hatte schon zu viele meiner Kameraden geholt, als das ich beruhigt auf See hätte bleiben können. Den Göttern – einer der wenigen Momente, da ich sie überhaupt in den Mund nahm – sei Dank war Jacky verschont geblieben. Nach meiner Rückkehr war meine Gefährtin in ihrem Betragen mir gegenüber zuerst kühl und reserviert, was ich ihr nicht verübeln konnte, Ruf hin oder her, es musste ihr vorgekommen sein, als hätte ich sie einfach im Stich gelassen. Da sie für längere Zeit nicht dem Fischen nachgehen konnte, der Broterwerb, dem sie üblicherweise neben den weniger legalen Geschäften nachging, vermochte sie vor allem dank der tatkräftigen Hilfe Miremars und Vinorys, die Zeit der Verwundung zu überstehen. Eine Zeitspanne, in der ich nicht bei ihr gewesen war, wie ich es hätte sein sollen.
Und da sage noch einmal eine verträumte Landratte, das Leben als Seemann sei romantisch und überirdisch schön…
Aber meine Kleingaunerin wäre nicht meine Kleingaunerin gewesen, hätte sie es mir nicht bald verziehen – es hatte nicht lange gewährt, da lagen wir uns schon wieder in den Armen, liebkosend und froh, den anderen bei sich zu wissen. Wir wussten beide, worauf wir uns eingelassen hatten, also lebten wir damit, so gut es eben ging.
Was Jacky anbetraf, so würde ich meine Bezeichnung der Kleinganovin für sie wohl bald überdenken müssen, denn wie es schien, hatte sie etwas Großes an der Angel. Selbstverständlich ist das bildlich zu sehen, ein Coup der besonderen Art. Sie hatte sich in ihrer Deckidentität Merith, einer liebenswürdigen Kammerzofe, eine Stellung bei einem Blaublüter in Hohenfels gesichert und wollte, so ihr Plan, dort das Vertrauen des hohen Herrn erschleichen und ihn dann immer wieder bei Gelegenheit um bewegliches Gut erleichtern. Ein nicht ungefährliches Unterfangen, hatte sie mir doch immer noch von Schauer gepackt davon berichtet, dass der Pfeffersack sie zu einer Hinrichtung einer Verräterin mitgenommen hätte, um ihr zu zeigen, was bei Verrat geschehe. Am Galgen war die Frau aufgehängt worden, unweigerlich hatte Jacky da an uns beide denken müssen.
Schande! Diese blaublütigen Mistschweine kannten auch kein Pardon oder Taktgefühl, was?!
Einmal mehr wurde mir klar, weshalb ich meiner Familie geflohen war und ihr die See vorzog.
Selbstverständlich nicht meine ganze Familie.
Meinen kleinen Bruder Ilbert und mich verband die besondere Art der Bruderliebe – eine Hassliebe, bei der oft und heftig die Fäuste flogen, zugleich aber zusammengehalten wurde (zumindest manchmal).
Heute an diesem 17. Wechselwind, da ich mich zu so früher Stunde auf Reisen begab, sollte ein guter Tag sein, was das brüderliche Verhältnis anging, denn heute hatte ich mir vorgenommen, Ilbert zu besuchen.

Da sein Haus weit im Osten Gerimors, nördlich von Adoran, lag, nahm ich meinen kleinen Kahn, um dorthin zu fahren. Auf derart weiten Entfernungen war man auf See einfach schneller, als an Land – zudem fühlte ich mich dort schlicht wohler. Dank des Frühjahrs waren die Küstengewässer sämtlich wieder schiffbar, nur auf hoher See musste man noch die Frühjahrsstürme in die Routenwahl einbeziehen – wahrlich, die neue „Saison“ konnte kommen. Handelsmarine.. aufgepasst!
Nach einigen Stunden ereignisloser Fahrt lief ich endlich im adoraner Hafen ein. Nach der üblichen Routine, bestehend aus ankern, festtauen, Zahlen der Hafengebühr und dabei möglichst harmlosem Gehabe konnte ich mich auf den langen Fußmarsch begeben, der jetzt noch vor mir lag. Ilberts Heim lag seiner Beschreibung nach nord-westlich von dem zugeschütteten Pass, der nördlich Adorans am Gebirge zu finden war. Also ging es immer der Nase nach auf der Straße gen Berchgard, mit der einzigen Ausnahme, dass ich nach dem kleinen Heerlager am Pass nach Westen in die Vorgebirgslandschaft abbog, dort musste irgendwo das Haus stehen. Mir war schleierhaft, wie man so weit ab vom Schuss, mitten in der Pampas leben konnte, wenn man eine so pulsierende Stadt wie Adoran in der Nähe hatte. Geschäfte konnte man auf dem Land jedenfalls nicht wirklich machen. Aber das war nicht mein Problem, Ilbert würde schon noch selbst darauf kommen.
Beim Anblick des sich hinter dem nächsten Hügel herausschälenden Gebäudes ließ mich meine lästernden Worte vergessen: Ein massives Steinhaus mitsamt einer eisenbewehrten Steinmauer um den Garten herum, wie ein Fels in der Brandung der Wildnis. Ich kam nicht umhin, mir bei dem näheren betrachten des Hauses einzugestehen, dass mein Bruder sich da ein ordentliches Heim hatte bauen lassen („Na, da rupft'er Klaboudermann sick'n Bart ous!“), sicher und massiv. Die Neugier, die mich um das halbe Gebäude geleitet hatte, führte mich zu einem ausladenden, glaslosen Fenster, an dessen Rand ich mich hochzog, um hinein zu sehen: Eine aufgeräumte, ordentliche Küche zeigte sich meinem Blicke, als auch ein quirliges Mädchen auf der Schwelle zur Frau, das zugegebenermaßen leicht bekleidet darin herumwuselte. Irgendwoher kam mir das Gesicht bekannt vor, doch ich vermochte es in dem Moment nicht näher einzuordnen. Die junge Frau entdeckte mich schlussendlich und winkte mir skurrilerweise freundlich zu, also grüßte ich zurück und fragte, als sie näher kam, nach dem Verbleib des Hausherren. Als sie mir in Gesten – dass sie nicht sprach, machte mir noch deutlicher, dass ich sie irgendwo schon einmal gesehen hatte – klar, dass er daheim sei. Mit einem zufriedenen Lächeln hob ich meine Stimme an und rief lauthals in das Haus hinein, indem ich meinen Bruder adressierte, dass ich nun reinkäme! Während ich breit grinsend und fröhlich vor mich hin pfeifend zur Haustür hinüberschlenderte, konnte ich mir schon vorstellen, wie Ilbert sich resigniert in die Situation ergab.
An der Haustür angekommen öffnete mir nach einer Weile, nachdem ich geklopft hatte, das Mädchen aus der Küche, das mir so bekannt vorkam.

Nachdem ich mich ihr mit meinem echten Namen vorgestellt hatte – wenn mein Gedächtnis recht stimmte, würde sie es eh nicht ausplaudern können, zudem wohnte sie offenbar bei meinem Bruder – wies sie auf ein Armband, das sie am linken Arm trug. Darauf war neben schlichtem Blatt- und Rankendekor ein Name eingraviert: Feyja. Hernach deutete sie auf sich selbst.
Aha.
Sie hieß also Feyja.
Im Wohnbereich des Hauses angekommen, sah ich Ilbert an einem großen Tisch sitzen, ein – Schrecken fuhr mir in die Glieder – Pantherjunges auf dem Schoß. Wie konnte er nur eine_KATZE_halten? Noch dazu ein Panther und schwarz? Hätte ich nicht das Amulett um den Hals getragen, ich wäre schnurstracks dem Haus geflohen. Mit Katzen, ob Hauskatzen, Straßenkatzen oder, schlimmer noch, RAUBkatzen konnte ich einfach nicht.
Als Ilbert sich auf mein Bitten hin erhob, um mich zu begrüßen, hatte ich felsenfest damit gerechnet, dass es wieder so enden würde, wie das letzte Mal: In einer Schlägerei. Doch nichts dergleichen, wir musterten uns nur nüchtern, mehr blieb aus. Während mein kleiner Bruder wieder einmal versuchte, mir den Unterschied von Pappnasen und „ehrenhaften Soldaten“ zu erklären, warf ich einen Seitenblick zu Fey und musste schmunzeln. Ein milder Fauststoß auf Ilberts Oberarm unterbrach ihn in dem hoffnungslosen Bestreben, meine geraunten Worte, dass er nichts anbrennen lasse, nötigten ihm selbst ein milder gestimmtes Schmunzeln ab. Fey indes blickte freundlich und neugierig drein, als könne sie kein Wässerchen trüben – gut, sie hatte es nicht gehört.
Hernach saßen wir bei Tisch und zu meiner Freude wurde ich reichlich bewirtet, mit einfacher, aber vorzüglicher Kost. Einige Brotscheiben und geräucherter Fisch, zum Nachspülen ein Bier vom Hof der Bäuerin Yette. Während ich zufrieden vor mich hin aß und trank verdaute ich die Neuigkeit, die ich soeben erfahren hatte, bevor wir uns gesetzt hatten. Ilbert, mein kleiner Bruder Ilbert war verlobt! Das Mädchen Fey war seine Verlobte! Bei allen guten Geistern, der Junge ließ nichts anbrennen, das musste man ihm lassen. Schwer zu kauen hatte ich nur an dem Gedanken, einstmals in einem Reichstempel unter lauter adoraner Bürgern stehen zu müssen, um der Hochzeit von Ilbert und Fey beiwohnen zu können. Eine Geduldsprobe der besonderen Art. Und vielleicht so mancher hohenfelser Würdenträger zum Greifen nahe… eine unvergleichliche Versuchung.
Zurück im Hier und Jetzt horchte ich die zwei ob wegen ihres Verhältnisses zueinander aus.
Sie hatten sich in Bajard kennen gelernt, das wunderte mich nicht, denn mir war mittlerweile aufgegangen, dass ich das Mädchen dort schon einmal in der Taverne angetroffen hatte. Scheinbar stumme junge Frauen waren nicht allzu häufig, man vergaß so eine Begegnung nicht, zumindest, was mich anbetraf. Später dann, auf die Frage hin, ob Fey stumm sei, wurde ich darüber aufgeklärt, dass sie es nicht war, sie jedoch wohl eine Vernarbung im Hals habe, die ihr das Sprechen sehr schmerzhaft mache, weswegen sie es weitestgehend unterlasse. So eine Scheiße. Sie konnte also doch reden! Ich würde mit Fey ein paar Takte unter vier Augen sprechen müssen, wenn sich die Gelegenheit bot, nicht auszudenken, wenn sie meinen Namen unbedacht ausplauderte. Familie war Familie, auch wenn ich zum Großteil meiner Sippe den Kontakt abgebrochen hatte, so war Ilbert immer noch das, was ich als meine Familie bezeichnete. Und bald würde Fey auch dazu gehören – vielleicht sollte ich versuchen, ihr zu trauen. Später einmal. Irgendwann. Vielleicht.
Bis auf weiteres wurden mir solche Gedankengänge abgenommen, denn Ilbert und ich befanden uns im Moment in einem der üblichen Zwiegespräche, die unserer beiden Ansichten zum Lebenswandel betrafen. Dieses Mal war mein Broterwerb das Thema. Um eine längere Diskussion vorzubeugen, zog ich mein Entermesser aus der Gürtelscheide und knallte es auf den Tisch, um in klaren, ungeschönten Worten klar zu machen, dass mein Gewerbe auch das Blutvergießen beinhaltete, wenn Sturheit auf der Gegenseite zu stark war. Rasch war das Gesprächsthema von dem unangenehmem Aspekt zu den Hohenfelsern gewandert, ein eingesessenes Adelshaus, dem die Herrschaft Ilbert zu Folge genommen worden wäre – was mir einerlei war. Der Graf und Kronritter Rafael von Arganta habe eine Belehnung erfahren, was mich zu einem Schabernack einlud: Ich machte Ilbert gegenüber deutlich, wie man mit Lösegeld in seinem Falle absahnen könne, was ihm die erwartete Entrüstung abverlangte. Zu gesetzes- und reichstreu, mein lieber Bruder. Es war Fey, die die zunehmend geladene Stimmung zwischen uns Brüdern wieder auflockerte: Mit wiederholten Gesten und einem fragenden Blick, der auf mir ruhte, bot sie sich den Krautstängel zum Probieren aus, den ich mir jüngst angezündet hatte. Bereitwillig rollte ich ihn ihr über den Tisch hinüber, für mich gab es keinen Grund, sie nicht gewähren zu lassen. Bei einer, wie sich noch herausstellen sollte, 16jährigen hatte ich keinerlei Bedenken. Wobei ich ehrlich gesagt auch einem achtjährigen Stempen Kraut verpasst hätte… Hauptsache, sie zahlten. Dieses Mal sollte es freilich nur eine Probe sein, wenn ich Glück hatte, kam Fey auf den Geschmack! Nach einem kräftiger als erwartet ausgefallenen Zug stellte sich aber in hartnäckigem Husten und Luftschnappen, wie auch Bände sprechender Mimik heraus, dass es nicht dazu kommen würde. Es schmeckte ihr schlichtweg überhaupt nicht. Schade. Hernach dann, als sie einen ganzen Krug Pfirsichmilch geleert hatte, um den Krautgeschmack loszuwerden und in ihrem ungestümen Wesen die gefühlte Hälfte davon über ihrem Oberkörper und Gesicht verteilt hatte, zeigte sich einmal mehr, wie eigentümlich und goldig zugleich dieses Mädchen doch war: Während wir noch von Seen, Flüssen und Bädern sprachen, um sie sauber zu bekommen, nahm sie die Milch schlicht mit ihren Händen auf und leckte sie sorgfältig ab… dies ging so weiter, bis sie halbwegs sauber war. Ich fühlte mich an Katzen erinnert und konnte nicht anders, als zu schmunzeln und meine Verwunderung Ilbert gegenüber zu artikulieren. Bei jeder anderen Person wäre ich wohl irritiert und auf der Hut gewesen, doch das war meines Bruders Verlobte – bei ihr fand ich es nur goldig und sympathisch. Und etwas eigen, das gebe ich zu. Aber mir stand ein Urteil nicht zu. Ich wies Ilbert nur noch darauf hin, dass er gut auf sie aufpassen sollte, denn es gab genug Männer meines Schlags, die nicht so freundlich waren und bei einem jungen Ding wie Fey unaussprechliches im Sinn hätten.
Bei Ilbert stand das natürlich außer Frage, selbst mir war offenkundig, wie sehr er sich zu ihr hingezogen fühlte und so konnte ich es nicht verstehen, dass Feys Schwester darauf bestand, dass die Hochzeit der beiden noch warten müsse bis – nach einer Weile des Ratens und Deutens ihrer Gesten war es klar geworden: - sie älter wäre. 16 Lenze war alt genug! Ich entbot mich, ihm bei der Überzeugung der Schwester beiseite zu stehen, schließlich sei er ja immer noch mein Bruder, dem ich helfen würde, wenn er Mucken hätte… er konnte es sich nicht verkneifen, mir genau Gegenteiliges zu bescheinigen, wenn ich in der Bredouille wäre – ganz der reichstreue Bürger. Er handelte sich einen kräftigen Rippenstoß von seiner Verlobten dafür ein, was mich darin bestärkte, diesem Mädchen Vertrauen zu schenken, hatte sie dadurch doch eine der wichtigsten Lektionen für ein Familiendasein gelernt: Loyalität.
Was den Aberglauben anging, schienen wir ja schon einmal auf selber Wellenlänge zu sein – sie hatte sich sehr interessiert an meinem Amulett gezeigt und nach meiner Erklärung von dessen Bestandteilen und Hintergründen nochmals ihr Armband gezeigt und warm zu mir gelächelt, was ich verstehend erwiderte. Wir pflegten uns damit gegen Unheil zu schützen – Ilbert konnte dem nichts abgewinnen, er fand sein Heil bei Temora. Jedem da seine, das war nur recht und billig.
Danach sprachen wir noch eine Weile über banales Alltagsgesülz, ehe ich mich von den beiden verabschiedete.
Ich wollte vor der Dunkelheit wieder daheim bei Jacky sein.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II
Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 18 Apr 2010 15:36, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 03 Mai 2010 14:13 Titel: Episode 19 - Von Glockentürmen und Farben Verfasst am: 03 Mai 2010 14:13 Titel: Episode 19 - Von Glockentürmen und Farben |
|
|
Episode 19 – Von Glockentürmen und Farben
02. Eluviar 253
Im Rahaler Hafenviertel, am Wegkreuz, in Bajard und nord-westlich von Berchgard
Der aufblühende Frühling versprach ein herrliches Geruchsbouquet, nur im Hafenviertel von Rahal sah das geringfügig anders aus.
Seit einigen Tagen spuckte die Erde dort Untote aus, verlorene Seelen, denen es nach dem Fleisch der Lebenden trachtete – unwillkürlich fühlte ich mich an den unglücklichen Einbrecher erinnert, den wir seinerzeit aus unserem Kamin gezogen und verscharrt hatten. War er unter diesen wandelnden Toten, die den üblichen Gossengeruch des Viertels mit ihrem Gestank nach Tod und Verwesung verpesteten? Mir schauderte es bei diesem Gedanken und ein rascher Kuss auf das silberne Amulett mit dem Smaragd, den mir Jacky einmal geschenkt hatte, beruhigte mich so weit, dass ich wagte, einen Fuß vor die Tür unseres Heims zu setzen. Entgegen besserem Wissen hatte ich es im Gegensatz zu meiner Gefährtin in Angriff genommen, trotz der untoten Horden nochmal zum Krähennest zu eilen, um meine Muskete zu holen, ohne die ich nicht sein wollte. Und überhaupt.. man musste sicherstellen, dass die wenigen Fenster und die zwei Türen unserer Bude sicher verriegelt waren – ich hatte wenig Interesse daran, faulende Überreste von diesen Seelenlosen aus unserer Bude zu kratzen. Zur Sicherheit verteilte ich noch zu Spänen vermahlenes Silber auf dem Boden der Hütte, ebenso an den Fenster- und Türrahmen, das würde selbst den zähesten Untoten abhalten!
Nachdem all das erledigt war eilte ich im Laufschritt und so manchen Haken schlagend durch die Horden von Untoten zum hafen, wo ich meinen Kahn angebunden hatte. Zum Glück waren die meisten Seelenlosen lahm und träge in ihren Bewegungen, so musste ich nur in einem Fall eine Silberkugel auf den Schädel eines Zombies verschwenden, der so dreist war, sich auf meinem Kahn breit zu machen. Kaum, dass dieser ungewünschte Ballast über Bord war, machte ich auch schon die Leinen los und setzte die Segel. Mein Ziel war weit nord-westlich von Rahal, am Wegkreuz, unweit des Nebelwaldes, eine Lokalität, die ich einmal mit Jacky betreten hatte und gewiss nie mehr betreten würde, wenn es nach mir ging. Es gab Gebiete auf dieser Welt, die waren den Menschen nicht bestimmt. Der Nebelwald war ein solches.
Kaum eine Stunde nach meiner Abfahrt kam ich an den Küsten des Wegkreuzes an und vertäute meinen Kahn am Steg eines dortigen Fischers und Gewährsmanns der Bruderschaft, ehe es zu Fuß weiter ins Inland ging, über aufblühende Weiden und erstarkende Felder, vorbei an so manchem Bauernhof, so mancher Viehherde. Endlich kam das Ziel meiner Reise in Sicht: Der Bauernhof von Elfriede Schweissgut.
Die Elstern gedachten, sich an diesem Nachmittag zu einer Versammlung auf dem Hof einzufinden, so war es selbstverständlich, dass ich als Verbindungsmann der Bruderschaft desgleichen anwesend sein würde – und meine Augen und Ohren offen hielt. Bei meiner Ankunft waren es erst ein paar Elstern, die anwesend waren – Durion, der ewig griesgrämige Schwertschwinger, Ydane, die einstige Müllerin, Iriel, kokett wie immer und natürlich die alte Elfride, mütterlich wie eh und je.
Aus schierer Gewohnheit ließ ich mich an dem gewohnten Platz an der rechten Tischflanke nieder, an der meine Gefährtin und ich stets zu sitzen pflegten und harrte der Dinge, die da kommen mochten. Das war zuerst freilich nur zweierlei: Warten und Tee trinken. Das Tee trinken indes musste in diesem Fall nur die Metapher bleiben, die sie üblicherweise auch ist – eine Tatsache, die es einmal zu ergründen wert schien, schließlich kam man als Seemann weit herum in der Welt.. irgendjemand musste den Ursprung dieser Redensart ja kennen. Wahrscheinlich die Menekaner, der Tee schien ja aus dem Süden zu stammen. Die meisten Teesorten waren mir ja wenig lieb, doch eine sehr dunkle, herbe Mischung, die gemeinhin als „schwarzer Tee“ bekannt war, schmeckte außerordentlich gut, besonders mit einem guten Schuss Rum. Oder auch umgekehrt, Rum mit einem Schuss schwarzem Tee. Beides sehr delikat. Nur an dem Verzehr musste man noch tüfteln: Wenn man die losen, getrockneten Teeblätter in dem gelöcherten Zangengefäß ins heiße Wasser tauchte, blieben unvermeidlich einige Blätter zurück, doch was für ein Seemann wäre ich, wenn ich mich ernsthaft daran stören würde?!

Mehr konnte ich auch nicht im Stillen über Tee philosophieren, denn die Reihen füllten sich langsam. Jacky, die noch Besorgungen in Bajard gemacht hatte und deswegen etwas verspätet dazu kam, gesellte sich neben mich an ihren gewohnten Platz, wir waren so gut wie vollständig. Abgesehen von jenen, die sich abgemeldet hatten.
Letztlich fiel es erneut mir zu, ein Protokoll der Versammlung abzufassen, nicht, dass es mich überrascht hätte. Wenn ich mich recht entsann, war ich einer der wenigen des Schreibens Mächtigen in dieser Runde, also sollte es so sein. Und es gab keine bessere Möglichkeit, als diese, um im selben Aufwasch eine zweite Abschrift davon für den Rat der Bruderschaft anzufertigen – man musste aus allem seinen Vorteil ziehen.
Die Versammlung selbst verlief für mich relativ uninteressant, wie meistens, es waren Angelegenheiten, die mich im Grunde nicht interessierten, zumindest nicht in dem Maß, wie ein Mitglied der Elstern. Und das war ich schließlich nicht. So protokollierte ich mehr oder weniger zuverlässig mit, trank mit Jacky zusammen den von ihr mitgebrachten Dattelwein und vertrieb mir die Zeit damit, mich im Flüsterton mit ihr zu unterhalten. Das einzige, was mein Interesse wirklich weckte, war die Erwähnung eines Hafen-Projekts, das der Bund anstrebte – die Landratten würden da sicherlich die Hilfe eines Seemanns brauchen, nicht auszudenken, wenn sie bei der Anlage der Mole oder Stege Mist bauten! Ansonsten war es das übliche Palavern, das einer Dorfversammlung alle Ehren gemacht hätte.
Der Abend war schon hereingebrochen, als die Runde sich auflöste und Jacky und ich uns nach Bajard begaben – wir wollten einen Trinken gehen. Vor dem Dorfeingang beobachteten wir kurz eine Schlägerei, in der skurrilerweise eine Laute als Knüppelersatz eingesetzt wurde; ein Kuriosum, das mich für einen Moment tatsächlich amüsierte und fesselte. Einen meiner Kameraden, den jungen Conde, ebenso, der gerade aus dem Dorf kam. Er blieb auch noch, als Jacky und ich uns wieder auf den Weg ins Dorf machten, er wollte vielleicht nachkommen und mir von dem Ergebnis der Schlägerei berichten. Er kam nicht mehr.
In der lokalen Taverne angekommen setzten wir uns an die Theke, während ich mir einen Krautstängle ansteckte, ging Jacky zur Schankmaid, um uns Rum zu besorgen. Ich hatte noch etwas Abfälliges darüber nachgerufen, dass man in dem Loch doch keinen Rum bekäme – und musste stutzen. Man bekam Rum! Da hatte der Alte wohl einen neuen Absatzmarkt für seinen Brand gefunden. Mir sollte es Recht sein! Es ging doch nichts über unseren guten, cabezianischen Rum!
Wir hatten kaum die Flasche geöffnet und beide ein paar Schlucke daraus genommen – es war zur Gewohnheit geworden, uns eine Flasche zu teilen – als ein weiterer Gast in die sonst leere Spelunke kam. Oder besser gesagt etwas hinkte: Der Kerl mit der Laute von vorhin. Wie es schien, hatte er die Schlägerei für sich entschieden. Der Lautenschwinger ließ sich eine Runde Schnaps servieren und trank nach Herzenslust, bis er sich zu uns gesellte. Ich hatte über den Hergang der Schlägerei wissen wollen und er gab bereitwillig Auskunft. Der Mann, der sich als Malak vorstellte, pflegte mit der Laute zu spielen und behauptete von sich, damit sogar manche Tiere beeinflussen zu können. Das machte mich hellhörig – Spielleute konnte man an Bord brauchen. Gut für die Moral und Kurzweil, noch dazu schien der Bursche kräftig zu sein. Ideal. Somit war es nicht nur reine Freundlichkeit, als wir da so beisammen saßen, tranken, Kraut rauchten und plauderten: Den Burschen wollte ich für unser Schiff! Freilich würde ich erst mit dem Käptn reden müssen, aber es war eine gute Sache, den Fiedler schon einmal auf die See hin auszuhorchen. Schwimmen konnte er angemessen, Furcht vor der See hatte er keine, er war kräftig, konnte Laute spielen… schien auf Abenteuer aus zu sein. Als ich ihm nämlich davon vorschwärmte (jeder Rekrutierungs-Sergeant hätte es nicht besser gekonnt), dass ihm Frauen, Reichtum und Abenteuer blühen würden, wenn er anheuerte, schien er davon äußerst erbaut zu sein. Ich nahm mir vor, den Kätpn oder einen meiner Offiziere zu fragen.
Die Pfeife voll Kraut, die Malak und ich teilten, vernebelte mir eine Weile lang den Geist. Und das mir, er ich als Krautbaron das Zeug ans Festland vertickte und ständig rauchte! Musste an dem Schlafmangel liegen, was auch immer. In einem Nebel nahm ich wahr, dass zwischenzeitlich Vin und Miremar mittranken, auch ein Mann, den ich zuvor noch beim Bauernhof gesehen hatte… als ich wieder klar denken konnte, waren wir jedenfalls nur noch zu dritt. Und ich war sichtlich irritiert. Am Kraut konnte es nicht liegen, dazu war ich ihm zu sehr verfallen... doch was dann?
Ich schob diese Grübeleien zur Seite und legte den Arm um meine Gefährtin, denn ich hatte das unbestimmte Gefühl, mein plötzliches Wegpennen widergutzumachen. Der Dritte an der Theke stellte sich als Wilderich heraus, ein junger Bergmann, von dem mir Jacky bereits erzählt hatte – ein potentieller Kandidat für die Elstern, so hieß es, und es hatte den Anschein, als würde man ihn noch ein wenig überzeugen müssen. Bald, nachdem ich wieder bei klarem Kopf war, hatte Will es eilig, zu Bett zu gehen, auf Lameriast (es gab wohl kaum einen wilderen Streifen Land in diesen Breiten). War natürlich seine Sache, doch ich kam nicht umhin, ihm mitzuteilen, dass es da Leute gäbe, die ihm etwas Besseres bieten konnten. Wieso nur einen Mann auf die See heiß machen, dachte ich mir. Da war der Bursche aber schon aus der Taverne entfleucht, nachdem er Jacky zu knuffen versucht hatte, eine Geste, die mir Falten in die Stirn trieb. Den Will musste ich einmal zur Seite nehmen, das sah ich schon.
Wir hatten den Schankraum nun für uns alleine, abgesehen von der Schankmaid, doch die zählte nicht – sie hielt sich diskret im Hintergrund, wie alle ihres Berufsschlags.
Aus Jaky sprach die Trunkenheit, als sie mich fragte, wann ich sie denn zum ersten Mal geküsst hätte. Damit tat ich ihr Unrecht, nein – nicht nur die Trunkenheit, doch etwas angeheitert war sie durchaus. Diese Frage kam so unerwartet, dass ich sie einen Moment lang stumm anschaute, während es hinter meiner Stirn werkelte. Zu viel gesoffen, du Nase, wann war das denn gewesen? Wann? Da ging die Tür und ein Mann stiefelte herein, um eine Bestellung bei der Schankmaid aufzugeben. Konsterniert sah ich ihm nach, bis er aus der Schenke verschwunden war, ehe ich mich wieder Jacky zuwandte und bekannte, dass ich es im Krähennest vermutete. Beim Klabautermann, so genau wusste ich es aber nicht mehr! Schande…. Jacky war dementsprechend auch etwas reserviert und gab mir, mich mit ihren vom Rum glasigen Augen im Fokus, eine zweite Chance, die ich zu ergreifen wusste. An unser erstes Zusammentreffen konnte ich mich nämlich weiß Gott noch gut erinnern, und selbst jetzt, so viele Monate danach schien es mir erst gestern gewesen zu sein. Heute wusste ich, weshalb: Damals war ich ihr verfallen, in der Taverne bei Tirell.
Jacky bekannte, dass sie ja nun noch Hoffnung sah und lehnte sich sanft an meine Schulter. Ich hätte es besser wissen müssen und den Schalk aus ihren vom Rum schwer gewordenen Worten hören müssen, doch ging ihr trotz allem in die Falle, zeigte mich konsterniert – was sie denn von mir denke? Ein ausgekochter Schuft sei ich, jawohl… hätte in jeder Taverne eine Frau, der ich einen gefallen schulden würde – sie grinste fröhlich dazu. Da konnte ich nicht anders, als aufzulachen, denn ich war ihr mal wieder auf den Leim gegangen und mit ihrer Feststellung, dass ich ihr jedoch verfallen wäre, hatte sie vollkommen Recht: Sie hatte mich gestohlen, vor langem schon – der einzige Mensch, der neben der See Bestand hatte. Sie hatte sich jetzt wieder zu mir hi gewandt und so lehnte ich mich vornüber, um mit dem Mund nah an ihrem linken Ohr zu sein:
„Is fearr an t-i graigh na an t-uaigneas“
Wenig später saß sie auf meinem Schoß, Arm in Arm, während wir von uns und dem sprachen, was uns verband. Vor einem Jahr hätte ich derartiges noch belächelt, doch nun, da ich mich selbst darin wiederfand, kam ich nicht umhin, mich darüber zu freuen. Ohne meine Gefährtin wäre das Leben schlicht, wie hatte ich an dem Abend doch gesagt? Richtig. Farblos, ohne Sinn und Inhalt. Das gefiel Jacky, die trotz oder gerade wegen ihrer Angetrunkenheit anhänglicher war als sonst.
Wir entschlossen uns schließlich, uns eine schöne Stelle im Wald zu suchen. Das Krähennest fiel der Untoten wegen flach – und bei den warmen Frühlingstemperaturen bot es sich einfach an.
Wir suchten und fanden sie in der Nähe von Berchgard, an der Küste des dortigen Flusses, kurz bevor er ins Meer mündete. Die freie Fläche am Waldrand war in einen Teppich von Blumen getaucht, deren süßlicher Geruch über dem Boden wallte und uns begrüßte. Es war stockduster, doch der helle Mond und die Sterne am klaren Himmel boten gerade genug Licht, um uns ein Lager zu richten: Die Stiefel dienten als Kissenersatz, meine Lederjacke würde uns die Decke ersetzen.

Als alles gerichtet war zog ich Jacky sanft mit hinunter ins Gras, in den milden Duft der Blumen hinab und als wir dort lagen, den Blick hinauf zum sternenbehangenen Firmament, das Brechen der Wellen im Ohr, wollte sie eine Geschichte von mir hören. Eine Liebesgeschichte. Als ob ich gut in so etwas wäre! Doch die allgemeine Stimmung, in der wir uns an diesme Abend befanden, ließ mich meine Zweifel vergessen und so erzählte ich eine Geschichte, die vage etwas damit zu tun hatte.
Sie handelte von einem jungen Studenten der Heilkunst namens Bernhard, der als kaltherziger, korrekter, emotionsloser Mensch mit einem Makel: Leidenschaft, für was auch immer, war ihm fremd, selbst seine Familie kannte ihn nur als kaltherzigen Menschen und das allein.
„Doch eines Tages, es war ein warmer Frühjahrsabend, wie wir ihn gerade haben… ein warmer Frühlingsabend wie dieser, da er an der nahen Küste seiner Heimatstadt ausritt.
Alleine, wie üblich.
Entgegen seiner üblichen Gepflogenheit ritt er spät abends aus - Und da erblickte er etwas auf der See, was ihm unbekannt schien. Wir, die wir es besser wissen, können es als das benennen, was es war: Ein Fischerboot beim Nachtfischen, denn er sah dieses flackernde Licht dort draußen in der Schwärze, das seine gesamte Aufmerksamkeit auf sich zog.
Nicht allein das Licht - Nein!
Vielmehr das, was er in dem Wiederschein davon sah!
…Oder auch nicht sah - denn spielte ihm nicht sein Geist einen Streich?
Er meinte, auf dem schwarzen Nichts, das das Meer war in dem Widerschein der schwankenden Lampe Spiegelungen im Wasser zu sehen.
Spiegelungen von Gebäuden - Einem Kirchturm, etwa.
Und dieser Augenblick war es, da er es auch hörte. Ein fernes Läuten, einem Flüstern gleich, das das Rauschen der Wellen an der Küste zu übertönen wusste.
Leis', ganz leis' drang es unserem korrekten, braven Medizin-Studenten ins Ohr, rief ihn förmlich zu sich. Als er seinen Wallach fast schon ins Wasser getrieben hatte, sah er sie schließlich:
Kaum ein paar Schritt entfernt von ihm, in dem vom Mondschein weißen Wasser tanzte das Abbild einer jungen Maid vor seinen Augen - oder war es nur ein Trugbild?
Blondes, welliges Haar fiel auf bare Schultern, die in ein fließend-seidiges Kleid übergingen.
Ebenso schnell, wie er sie gesehen hatte, war sie wieder fort gewesen - der Hauch ihrer Worte verfolgte ihn jedoch all die Tage und Nächte nach diesem Ausritt.
''Komm zu mir.''
Bald sahen seine Angehörigen einen Wandel mit ihrem ach so kaltherzigen Bernhard geschehen:
Der Medizin-Student begann, sich für die Musik zu interessieren, las auf einmal Gedichte, die er früher verlacht, übte sich sogar selbst als Poet!
Er erschien ihnen, wie all den anderen, die ihn näher kannten, ein anderer Mensch zu sein.
Und jeden Abend ritt er nun aus, an jenen Ort am Meer, die Maid aber, die sah er nicht.
Irgendwann wurde seine Ungeduld so groß, die Inbrunst in seiner Brust so übermächtig, dass er einen Fischer vom nahen Hafendorf dafür bezahlte, ihm seinen Kahn zu überlassen.
Das war, wie wir es wissen, genau einen Monat nach seiner heißersehnten Begegnung.
Er fuhr hinaus, auf's Meer, vor der Küste, in Sichtweite des Hafens, ließ er die Ruder sinken und saß einfach nur da. Er lauschte, sah sich um, als fürchte er, etwas zu übersehen.
Seine Gebete wurden diese Nacht erhört - der Mond stand hoch, als er wieder das vertraute Glockenläuten vernahm, fern, wie im Traum. Da legte er sich auf das Boot, um mit dem Kopf direkt über der Wasseroberfläche zu sein, lauschte und harrte aus.
Er wollte ''sie'' sehen, nur einmal.. noch.. einmal.
Sie kam auch.
Zuerst war es nur ein leiser, sandfarbener Schein im Dunkel des Meeres, als sie aus der Tiefe empor kam, bald schon zeigten sich die Feinheiten ihrer edlen Züge. Und dem jungen Studenten wurde es warm ums Herz: Diese hohen Wangenknochen, diese seidig-weiche Haut... doch besonders ihre Augen, in denen die Welt zu ruhen schien, raubten ihm erneut schier den Atem.
Auf einmal war sie ihm nah, so nah, wie er es nicht erhofft hätte, überraschend warme Hände umfingen ihn sanft, obwohl das Meer doch so kalt war…
''Komm zu mir, Bernhard'' - da war sie wieder, diese warme, liebe Stimme.
Und da wusste der Medizin-Student Bernhard, was er zu tun hatte. Er empfing die Maid mit offenen Armen, folgte ihr hinab in die dunkle, kalte See. Doch so dunkel und kalt war sie nicht.
Weite Fluren von Seegras, an deren weit entfernten Enden die Silhouetten von Gebäuden zu sehen waren verrieten es. Schon bald fand er sich in einer Welt wieder, die er nicht für möglich gehalten hätte. Das Dorf, das er gesehen hatte, existierte dort unten, auf dem Grund des Meeres. Und es war höchst lebendig.
Er wusste nicht, wieso - doch als er schon dachte, ersticken zu müssen, für seine törichten Träumereien sterben zu müssen atmete er ein - und lebte weiter. Seine Maid schenkte ihm ein wissendes Lächeln und führte ihn, der ihr völlig verfallen war, weiter hin zu Tempel.
Die Bewohner des Dorfes waren gänzlich verschieden zu ihr, der Maid.
Sie hatten nur rudimentär etwas mit Menschen gemein: Ihre Kleidung war durchweg jene, die der Student kannte, altmodischer zwar, aber bekannt. Nur die ''Menschen'' darin waren schier phantastisch! Da gab es aufrecht gehende Krebse mit Monokeln und Gehstock oder dürre Schleihen, die ihre Postlieferungen eilig auf fast durchsichtigen Flossen, die ihre Gliedmaßen waren, fort brachten.
Zu jenen Krebsartigen zählte der Kaplan, der die Maid und ihre Eroberung am Portal erwartete
Ehelichen, jawohl, das wollte die Maid ihren Medizinstudenten Bernhard und der junge Mann, betört von ihrer Schönheit und wirr von all dem Phantastischen um ihn wähnte sich in Sicherheit.
Doch als ihm offengelegt wurde, welches Schicksal ihm blühte, schwankte er.
Vier Monde an Land, acht am Grund des Meeres.
Das war es, was ihm blühte, wenn er seine Maid zur Frau nehmen wollte.
Doch wehe, es ging nicht nur um ihn allein!
Würde er sie erst geehelicht haben, so wäre es auch der holden Maid erspart, das Schicksal ihrer Nachbarn zu teilen. Sie war makellos, schön, phantastisch zwar, aber nicht ''so'', wie all die anderen dort unten. Da biss ihn, der er einstmals so kaltherzig war, das Gewissen.
Konnte er, nur um mit dieser Frau, die ihn zu fühlen - ja, überhaupt leben - gelernt hatte, beisammen sein zu können seine alte Mutter und seine Schwester zurücklassen?
Unter dieser drohenden Unbill schwankte er und es schien einen Moment lang, als würde er straucheln, aber die tiefen, blauen Augen, die für ihn die ganze Welt beherbergten nahmen ihm seine Unsicherheit.
Am nächsten Morgen fand man das Fischerboot, angespült ans Ufer - ohne den Studenten Bernhard, der es gekauft hatte. Die Fischer machten sich auf die Suche nach dem jungen Mann, fanden nichts, keine Spur von ihm. Nur ein alter Fischer, dessen sonnengegerbte Haut Leder glich, wusste der alten, vor Sorge schier kranken Mutter Auskunft zu geben:
Hier, kaum eine halbe Meile vor der Küste, so sprach er zu ihr, gab es einmal ein Dorf.
Die Einwohner waren durch den Seehandel reich geworden, reich und selbstherrlich. Irgendwann jagten sie ihren Priester, der stets darum bemüht war, die Tugend zu predigen und dem Laster zu eifern, aus ihrer Stadt. Mit Schande, Schund und so manchem Fluch auf die Götter.
Der Priester habe sie alle verflucht, so heißt es, und schon bald, genau einen Mond nach der Vertreibung des Priesters und der Schändung des Tempels versank die Stadt im Meer.
Aber die Menschen ertranken nicht, sie lebten weiter, ohne Aussicht darauf, jemals wieder das Tageslicht zu sehen. In ihrer Gnade hatten die Götter nur eine Ausflucht gelassen:
Derjenige, der sich der Liebe eines Landgängers sicher sein konnte, dem würde vergeben werden. All das, so der alte Fischer, sei zu Jugendzeiten seines Großvaters geschehen, und seitdem habe es Geschichten darüber gegeben. Über Glockenschläge im Dunkel, eine Stadt, die man noch immer im Spiegelbild sähe und eben jene Maid.
Was der Alte nicht wusste: Unter den Zuhörern befand sich jene Maid und neben ihr der Student Bernhard, der sein Glück gefunden hatte - denn er war zurückgekehrt, um seiner Familie das zu geben, was er ihr so lange verwehrt hatte.
Vier Monate an Land, die mehr wogen, als ein ganzes Leben.
Nach diesem Jahr allerdings sah man weder Bernhard noch seine Maid jemals wieder in diesen Landen.
Die Erzählungen über die Stadt im Meer wurden vergessen.
Doch bis heute, meine Liebe, erzählt man sich von jenem Studenten und seiner Maid.“
Meine Worte verklangen in der Nacht und wir lagen noch lange wach.
Es war das erste Mal, dass wir unter freiem Himmel beieinander lagen, nun, da es warm genug dafür war – und wir wollten es reichlich auskosten.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 07 Jun 2010 16:24 Titel: Episode 20 – Fiche bliain faoi bhláth Verfasst am: 07 Jun 2010 16:24 Titel: Episode 20 – Fiche bliain faoi bhláth |
|
|
Episode 20 – Fiche bliain faoi bhláth Teil 1: Ver-trauen
03. Schwalbenkunft 253
Im Rahaler Hafenviertel
Jacky hatte mich vor einiger Zeit mit einer Neuigkeit überrumpelt, die mich vor einigen Monden noch das Land hätte fliehen lassen; jetzt war ich darüber nur heilfroh und glücklich.
Wir würden Nachwuchs bekommen.
Seitdem war einiges geschehen: Will, der sich offenkundig an Jacky herangeschmissen hatte, war von einem Tag auf den anderen reserviert und kühl, was mir nur Recht war. Ich konnte Bergleute noch nie wirklich ausstehen, erst recht nicht, wenn sie meiner Gefährtin den Hof machten.
Kiebitz und Iri waren fast aus allen Wolken gefallen, als sie – ebenso wie ich, der ich an dem Tag einen halben Herzinfarkt bekommen hatte – zum ersten Mal die Kunde, dass Jacky in anderen Umständen wäre, aus ihrem Mund hörten. Kiebitz hatte sich in Folge dessen in ihrem gewohnten Sarkasmus nahezu selbst übertroffen, während ihre Schwester kurzzeitig sogar nahezu verschlossen oder betrübt wirkte. Mir war das alles an dem Tage nur durch einen Schleier heran gedrungen, denn meine herzinfarktartige Überraschung, die zuerst als Betroffenheit gewertet worden war, hatte ihren Ursprung in einem unbändigen, tiefen Frohsinn, der mich die folgenden Tage noch im Griff halten sollte und stärker wirkte, als das beste Kraut, das ich vertickte. Es waren glückliche Tage.
Dann musste ich auf See.
An diesem 03. Schwalbenkunft, es war schon einige Tage her, dass ich wieder an Land gekommen war, wachte ich erst spät auf. Nach ausgiebigem Gähnen und strecken, letzteres bewies mir, dass meine Blessuren fast gänzlich verheilt waren, wollte ich auf den Innenhof hinter unserer Hütte, meinen morgendlichen Krautstängel zu genießen. Selbst, wenn der vermeintliche Morgen ein Nachmittag war. Gerade, als ich die Tür geöffnet hatte und hinaustreten wollte, erschien Jacky vor mir, in dem Bestreben, einzutreten. Vor Schreck traf mich halb der Schlag, sämtliche Farbe wich für den Bruchteil einer Sekunde aus meinem Gesicht und meiner Gefährtin ging es nicht besser. Nachdem wir uns gefangen hatten, begrüßten wir uns lächelnd und ich ließ den Krautstängel Krautstängel sein und ging mit ihr zurück in die Bude, wo wir es uns gemütlich machten und den Nachmittag miteinander verbrachten. Sie sprach mit mir über den bevorstehenden Krieg, dessen Vorboten wie ein Damokles-Schwert über allem hingen und ihr war überhaupt nicht recht, dass unser Pack womöglich an den Kampfhandlungen teilnehmen würde. Auf welcher Seite auch immer – am wahrscheinlichsten war freilich die Partei Rahals. Es war nicht in meinem Sinn, sie zu beunruhigen, also wechselte ich rasch das Thema zu La Cabeza. Zur Zeit herrschte dort Chaos, der Vulkan war ausgebrochen und hatte uns zur Flucht gezwungen (Ein Hinweis für den geneigten Leser – Näheres dazu findet sich in den Erzählungen zu den Kaperfahrten), wenn dort wieder Frieden herrschte, wollte ich mir dort eine größere Bude einrichten, damit Jacky, ich und… in kaum vier Mondläufen wohl auch unser Nachwuchs dort eine sichere Zuflucht hätten. Sicher vor den Kriegen der Reiche, sicher vor den Fanatikern der religiösen Orden. Sicher… vor allem, dem die Nation der Piraten und Schmuggler in ihrem Streben nach Freiheit den Kampf angesagt hatte.
Unvermittelt hatte sie mich an diesem unbeschwerten Nachmittag schließlich gefragt, ob ich bezüglich unserer Beziehung und dem Kind, das sie erwartete, schon gesprochen hätte. Das hatte ich negieren müssen, da ich auf dem Seeweg nach Rahal in den Wirren der Fahrt und danach keine Zeit gefunden hatte, unter vier Augen mit Perera reden zu können. Jacky war davon wenig begeistert und fasste ihre Befürchtungen sogleich in Worte: Sie hielt mir vor, dass ich mich nicht trauen würde, da sie „eine Landratte“ sei, bei Gracia oder den anderen Weibern aus meinem pack wäre es mir doch egal, nur bei ihr…. Ich konnte sie nur einen Moment lang perplex anschauen, ehe ich überhaupt Worte fand. Und doch hatte sie ja Recht.. vor nicht allzu langer Zeit hatte ich mich wirklich nicht getraut, kundzutun, mit einer Landratte zusammen zu sein. Aber beim Klabautermann, das war ja schon… ewig her! Es gab kaum einen Kameraden, der nicht wusste, dass Jacky meine Gefährtin war! Kur darauf sollte mir dann klar werden, dass es eigentlich auch gar nicht darum ging, sondern eher um die „offizielle“ Seite. Oder anders gesagt: Heirat – so wie es „Vallas und Charly“ gemacht hätten. Daher wehte also der Wind! Ich hrochte in mich hinein und – war überrascht. Da verspürte ich keine Abneigung, keine Gram oder Furcht davor, mich zu binden, wie ich es vor einem Jahr noch hatte. Pure, blanke Begeisterung im klassischen Sinne, wie man es sich in den Theatervorführungen immer gegenseitig beschwor… allerdings auch nicht. Ich will es so ausdrücken: Da es ihr so viel ebdeutete und ich nicht dagegen einzuwenden wusste, tat ich das, was mir am besten erschien – ich befand es als gute Idee, wenn wir uns trauen würden. So würde ich ihr, so dachte ich im Stillen, wenigstens eine Freude machen und ganz nebenbei meinen Bruder beruhigen, der mich schon schief wegen meiner ehelosen Beziehung zu Jacky angesehen hatte. Mehr als einmal.
Dieses lockere Halb-Interesse an dem Umstand Heirat wurde von einem Moment auf den anderen zu schweißtreibender Unruhe, als es an mir lag, meine Gefährtin noch… zu fragen.
Aye, richtig gehört, wie jeder weiß, gehört zu einer ordentlichen Heirat auch, dass der künftige Bräutigam seine Dame um ihre Hand bittet. Bürgerliches Schnöselgehabe, wenn man mich fragt, aber ich kramte trotzdem die Knigge-Lehrstunden meines Onkels heraus. Jedenfalls versuchte ich es, doch dieses Mal gelang es mir nicht, den üblichen Schalk hinein zu bekommen; ich war ehrlich aufgeregt.
Schließlich schaffte ich es nach mehreren Anläufen doch noch, die Worte heraus zu bekommen.
„Jacky - willst'e meene Frouwe wer'n?“

Episode 20 – Fiche bliain faoi bhláth Teil 2: Die Jagd
06. Schwalbenkunft 253
In Bajard und den umliegenden Wäldern
Tiefe Wälder waren mir spätestens seit unserem Besuch im Nebelwald nicht geheuer, so sehr ich es Jacky gegenüber auch nicht zugab, doch wahrlich, so war es. Und heute sah ich mich zusammen mit einigen anderen als Teil einer Jagdgruppe durch den Forst nord-westlich Bajards schleichen!
Als ob ich es nicht besser wüsste.
Wir hatten uns im Zuge des Herbergsfest der Zacs vor deren Herberge eingefunden und waren am späten Nachmittag losgezogen. Beldan Scherenbrück, mit Pike, Anton Weidemann, mit Bogen, Siran, mit dem Spieß und schließlich ich selbst, mit meiner Muskete. Bis auf Anton waren wir allesamt ungeübt in der Jagd und mussten uns auf das Gespür des Waidmanns verlassen, wenn wir an diesem Abend noch Beute machen wollten. Kurzum: Ich war reichlich skeptisch, ob mir überhaupt ein Rebhuhn vor die Flinte laufen würde. Mit einem stillen Lächeln registrierte ich, dass es in Sachen Jagdgesellschaft wohl bei uns bleiben würde, kein Adeliger oder Pfeffersack, in dessen Rücken sich „versehentlich“ eine Kugel verirren konnte oder der im Verlauf der Pirsch „verloren“ ging. Schade. Das womöglich daraus resultierende Kleingeld hätte ich gut gebrauchen können, nachdem das letzte größere Krautgeschäft reichlich in die Hose gegangen war. Jacky befand sich mittlerweile im… fünften Monat, wenn ich mich nicht irrte, und ich konnte nur hoffen, dass der Vulkan auf La Cabeza bald zur Ruhe kam, um endlich dorthin zurückkehren zu können. Das Festland war nicht der Ort, wo ich sie und unser Kind wissen wollte, es roch allenthalben nach Krieg. Ein Krieg, in dem wir, die Männer Pereras, unseren Teil leisten würden – was ich Jacky so gut es ging verheimlichen würde. Es bestand kein Grund dazu, es ihr mitzuteilen, und wenn etwas schief ging, dann war für alles gesorgt.
Mit einem heftigen Kopfschütteln jagte ich die Gedanken fort und zwang mich, wieder auf das Hier und Jetzt zu achten. Wir waren schon seit einiger Zeit in den Tiefen des Waldes versunken und um uns herum war nur die emsige Stille, wie sie typisch für den Forst war: Vogelgezwitscher, das Rascheln von Laub im Wind, hier und da ein Knacksen. Mir war schleierhaft, wie Anton hier überhaupt eine brauchbare Fährte gefunden hatte, doch er hatte es – sie war es auch, die uns hierher geführt hatte. Die Mühen sollten belohnt werden, denn die Hirschkuh, die uns Anton schon angekündigt hatte, bevor wir sie überhaupt sahen, brach jäh aus dem Dickicht vor uns und preschte davon. Rufend und eilend ging es ihr nach! Der alte Beldan blieb etwas zurück, was mich auch nicht wunderte, er schien ein verhärmter Haudegen zu sein, sollte er es ruhig angehen… wir jüngeren übernahmen den Part der Hatz. Wie wild, Haken schlagend, mal springend, mal geduckt ging es der Hirschkuh nach durch das dichte Laubwerk des Waldes. Der Jäger Anton voran dicht gefolgt von mir, auf unserem Parcours durch das Dickicht verloren die beiden anderen den Anschluss. Nach einigen Hundert Schritt war sie da, die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte: Anton hatte der Hirschkuh einen Pfeil nachgejagt, als sie eine freie Fläche passierte – da kniete ich mich rasch hin, legte die bereits schussfertige Muskete an und drückte ab. Unter lautem Donnern und einem forschen Züngeln von Flammen und Pulverresten schickte sich die Kugel an, den Abstand zwischen ihr und der Hirschkuh förmlich zu fressen: Es gab ein schmatzend-krachendes Geräusch, als die Kugel in den Leib des Tieres drang und es förmlich niederfegte. Ein breites, zufriedenes Grienen stahl sich auf meine Lippen, als ich keuchend und nach Luft ringend zu Anton und der toten Hirschkuh aufschloss. Der Jäger lobte anerkennend den guten Schuss und ich ertappte mich dabei, darüber erquickt zu sein – als Seemann war ich schließlich an Land nicht wirklich daheim und hatte unter drei Landratten, einer davon sogar Jäger, die erste Beute des Tages geschossen. Ha! Wenn das nicht Auftrieb gab! Nachdem ich mir die noch recht kleine und damit halbwegs leichte Hirschkuh auf die Schultern geworfen hatte (die Beine hatten wir gebunden) und die beiden anderen dank des lauten Donnerschalls des Schusses zu uns aufgeschlossen hatten, ging es weiter. Kaum eine halbe Stunde später sah es so aus, als würden wir heute kein Wild mehr erwischen, ein Wolfsrudel querte unseren Weg und stob verschreckt davon, als es uns bemerkte, doch dabei blieb es. Keine Damwild, kein Rotwild… da fiel mir ein auffälliges Knacken etwas weiter westlich unserer Position auf. Zuerst tat ich es als harmlos ab und überhaupt, Anton hatte keine Fährte ausgemacht, also konnte da doch nichts in der Gegend sein, oder? Mehr einem Bauchgefühl als der Vernunft folgend wandte ich mich letztlich doch nach Westen und pirschte in geduckter Haltung vorsichtig davon, nachdem ich den anderen leise vermittelt hatte, etwas gehört zu haben. Nach wenigen Schritten erreichte ich eine kleine Lichtung mit niedrigem, saftig-grünem Gras und dort stand er.

Ein kräftiger, kapitaler Rothirsch stand dort und äste ahnungslos. Sein prächtiges Fell glänzte in dem letzten Aufbäumen der untergehenden Sonne – viel Zeit blieb uns nicht mehr. Leise wollte ich den Hahn der Muskete spannen, da schoss sein Haupt empor und die kräftigen Muskeln spannten sich unter seinem Fell sichtbar. Scheiße, er musste uns gewittert haben. Als hätte er meine Gedanken gehört, machte der Hirsch urplötzlich kehrt und schoss springend auf das gegenüberliegende Dickicht zu, um nur Augenblicke später darin zu verschwinden. Fluchend eilten wir alle ihm nach, diesmal darauf bedacht, zusammen zu bleiben. Keuchend kamen wir an einer schmalen Schneise zum Stehen, die sich durch den sonst dichten Wald zog: Wahrscheinlich ein Pfad, der vom Wild ausgetreten worden war. Wir dachten schon, seine Spur verloren zu haben, da zeigte uns er Hirsch seine Nähe durch ein weithin hörbares, charakteristisches Schaben – es entstand, wenn ein Hirsch sein Geweih an einem Baumstamm schabte, soweit ich wusste. Still schwor uns Beldan, der alte Militär, darauf ein, in einer Zangenbewegung vorzugehen: Siran und er selbst würden mit ihren Spießen zu beiden Seiten des Pfads einen weiten Bogen machen und dem Hirsch den Fluchtweg abschneiden, während Anton und ich mit unseren Schusswaffen dafür sorgen würden, den Hirsch zu erlegen. Nachdem Siran und Beldan im Unterholz verschwunden waren, warteten Anton und ich noch eine Weile, ehe wir uns daran machten, den Pfad entlang zu pirschen. Das Geschabe hatte uns nicht getuscht: Der Hirsch war dort. Wir näherten uns ihm im dichten Unterholz auf bis gut 20 Schritt, ehe wir in Position gingen. Anton mit aufgelegtem Pfeil und bereit zum Schuss hoch aufgereckt. Ich selbst niedergekniet, um meinen Arm und die Muskete auf dem Knie abstützen zu können; der Schuss musste sitzen. Noch eine Gelegenheit würden wir heute nicht bekommen, denn die Dämmerung brach unweigerlich herein. Ein kurzes Aufblitzen einer Spießklinge gegenüber der Schneise machte mir klar, dass die beiden Trieber auch bereit standen. Anton musste es auch gesehen haben, denn er zog Pfeil und Sehne nach hinten und zielte auf den Hirsch, so legte auch ich auf das Tier an. Ein leises Surren erklang, als der Pfeil die Sehne verließ und der Hirsch reckte sein Haupt bei dem verdächtigen Geräusch, doch da war es schon zu spät: Mit einem dumpfen „Stack!“ traf ihn der Pfeil in die Hüfte und der Hirsch verharrte nur den Bruchteil einer Sekunde, ehe er zu Tode erschrocken und sicherlich wie wahnsinnig vor Schmerz lospreschte, zuerst schnell, dann langsamer und hinkend, bisweilen strauchelnd – der Pfeil musste sich tief ins Gelenk gegraben haben. Während der Hirsch so die Schneise entlang lief zielte ich bedächtig und sorgfältig. Es war genug Zeit, mehr als genug… Zeit… langsam drückte ich den Abzug nach hinten, bis zum Anschlagpunkt, ein kurzes Überprüfen des Ziels, dann drückte ich zur Gänze durch. Der Schuss ging donnernd los und die aus dem Lauf preschende Feuer- und Pulverdampfwolke nahm mir die direkte Sicht auf den Hirsch. Beldan und Siran brachen aus dem Dickicht zu beiden Seiten und eilten dem Hirsch mit erhobenen Spießen hinterher, weit laufen mussten sie nicht, wie sich nach dem Lichten des Rauchs zeigte. Die Ladung hatte den ohnehin schwer getroffenen Hirschbock niedergemacht. Nun war es an Siran, ihm den Gnadenstoß zu geben.
Bald darauf befanden wir uns in der hereinbrechenden Dunkelheit auf der Straße nach Bajard. Siran und Beldan schleppten den kapitalen Hirschbock aufgehängt auf der Pike des alten Haudegens, während ich vorausging. Anton hatte sich zwischenzeitlich abgesetzt, wollte wohl noch kundschaften.
Auf halbem Wege hatten wir noch eine unliebsame Begegnung mit einem wildgewordenen Grizzlybären, der uns die Beute streitig machen wollte und dumm genug war, sich nicht zu trollen. Da er uns vielmehr angriff, fing er sich eine Kugel und zwei Spieße in die Rippen ein und würde künftig bei keinen fleißigen Jägern mehr Mundraub begehen. Bei der Freien Herberge angekommen verabschiedete ich mich für den Moment von meinen Jagd-Gefährten und überließ es ihnen, das Wild auszunehmen und für die Gäste zu braten, Kochen war nun wirklich nicht mein Fall und das erschien mir als die eleganteste Art, mich aus der Affäre zu ziehen.
Gut eine Stunde später kehrte ich zusammen mit Feyja, die ich zwischenzeitlich angetroffen hatte, zurück. Mittlerweile hatte sich eine kleine, gemütliche Runde gebildet, in der Erzählungen zum besten gegeben wurden und so manches Bier getrunken wurde. Feyja sicherte sich einen guten Teil des übrigen Fleisches – mit der Hauptgrund, warum sie mit hergekommen war und ich ließ ihr die Freude, um mich währenddessen der Pflege meiner Muskete zu widmen. Ich hantierte sehr sorgfältig und bedächtig mit ihr, sie hatte heute ausgezeichnete Dienste geleistet und hatte das verdient – außerdem war ich mir es sonderbaren Blickes einer mir gegenüber sitzenden Frau bewusst. Ich war skeptisch geworden. Als ich den Abzug der Muskete betätigt hatte, um probehalber den Hahn schlagen zu lassen, war sie sichtbar zusammen gezuckt – was mich in meiner Skepsis unterstützte. War sie eine von uns…? Vielleicht eine erst jüngst Angeheuerte? Ihr Gesicht kannte ich jedenfalls nicht.. die klare, bauchige Silhouette eines Bechers, der direkt vor meine Nase gehalten wurde, ließ mich hochschauen. Fey. Nachdem ich den Becher Apfelwein entgegen genommen hatte, bleiben wir auf der Bank hocken, um dem beginnenden Bogenschieß-Turnier zuzusehen und den Wein zu trinken. Im Stillen war ich überrascht, dass das Mädchen Wein trank, und zugleich verspürte ich ein leises Schuldgefühl, da ich nun doch Alkohol trank, wenn auch wenig. Für Schuldgefühle war der Wein aber zu gut – und deutlich zu schwach!
Während sich die Gäste, die des Bogenschießens mächtig waren, untereinander maßen, eröffnete mir Fey in ihrer eigentümlichen, nahezu gänzlich ohne Worte auskommenden Art der Artikulation (ein Leiden am Kehlkopf, wie sie einmal in leisem Krächzen erzählt hatte), dass Ilbert sie in letzter Zeit ziemlich vernachlässigte, ja sogar fortschickte, zu Gunsten des Wachdiensts am Kloster. Das klang ganz nach meinem kleinen Bruder. Pflichtbewusst, geradlinig, korrekt, Pflicht vor Privatem. Wie unser verfluchter Vater. Mit dem Versprechen, dass ich mit Ilbert ein paar (für mich war klar: faustreiche) Takte sprechen würde, verabschiedete ich mich von dem Mädchen und den restlichen Gästen, um meiner Wege zu gehen.
Es war schon spät genug und ich wollte daheim sein, solange Jacky noch wach war.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II
Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 07 Jun 2010 16:25, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 06 Jul 2010 14:07 Titel: Episode 21 – Gefangen Verfasst am: 06 Jul 2010 14:07 Titel: Episode 21 – Gefangen |
|
|
Episode 21 – Gefangen
05. Cirmiasum 253
Im Rahaler Hafenviertel
Der Galgen wartete auf jeden von uns.
Sei es die Piraterie, das Morden oder das Plündern – alles Grund genug für die Reichsjustiz, unseresgleichen aufzuknüpfen, wenn sie denn unser habhaft wurden. Und nun hatten sie Vallas.
Wie genau es dazu kam, wusste ich nicht, doch in Adoran hatten sie ihn aufgegriffen und festgesetzt – wie mir von einem unserer Spione zugetragen worden war, bestand bereits eine Anklageschrift gegen ihn, die es in sich hatte. Erst heute Nachmittag waren Pläne an Bord gefasst worden, indem einige unserer Matrosen, die in Alumenas nicht heimisch waren, sich in Adoran umhören sollten, um Näheres in Erfahrung zu bringen. Ehe nicht Aufenthaltsort, Wachen-Stärke und anderes bekannt war, konnten wir keine weitergehenden Pläne zu seiner Befreiung schmieden. Es war eine verfluchte Schande. Unser Smutje in adoraner Gefangenschaft!
Mein 1. Maat und ich hatten mit der Befreiung von gefangenen schon unsere Erfahrung gemacht, man entsinne sich an dieser Stelle unserer Nacht- und Nebelaktion, um Kimroth herauszuholen – doch dieses Mal war es nicht so leicht. Mein Kamerad war in Alumenas berüchtigt, insbesondere das Adelshaus derer von Hohenfels hatte er sich zum Feind gemacht, zumal er familiäre Beziehungen zu einem hochrangigen Soldaten hatte, die nicht gerade als harmonisch bezeichnet werden konnte. Man würde Vallas sicher deutlich stärker und gründlicher bewachen, als Kimroth seinerzeit, der nur in Rahal agierte, nicht global. Doch wie vorgehen? Den nächstbesten Adeligen aus Alumenas entführen und für einen Gefangenenaustausch verwenden? Den Käptn dazu überreden, mit der Toro de Muerte Adoran von der Weltkarte zu tilgen? Im Moment galt es, zu spionieren. Hernach würde man sehen, was die beste Vorgehensweise sein würde. Zwei meiner Matrosen waren bereits auf dem Weg in die Residenzstadt der Grafschaft Meereswacht.
Noch während ich mir darüber Gedanken machte, legte die Barkasse, mit der ich mich von der Toro an Land übersetzen ließ an und ich stieg von Bord.
Zumindest die nächsten Stunden wollte ich mich von den Sorgen lossagen und mit meiner Gefährtin verbringen – wie zu erwarten war, traf ich sie im Krähennest an, damit zu Gange, ihr Gewand zurecht zu zupfen. Als ich so im Raum stand und sie still beobachtete (Jacky hatte mich noch nicht bemerkt) stellte ich fest, dass die Schwangerschaft ihr mittlerweile mehr als überdeutlich anzusehen war. Sie war ‚mehr‘ geworden, was in der Natur der Sache lag – und so mancher Bereich, der an Volumen zunahm, gefiel mir im äußersten Maße, wenn ich ehrlich war. In wenigen Monden würde die Entbindung sein, wofür wir bereits vorgesorgt hatten. Jacky hatte sich die Unterstützung meines 1. Maats Gracia zugesichert, ebenso hatten wir einen der neuesten meiner Matrosen, Levi, zum unfreiwilligen Helfer ernannt. Irgendjemand musste ja das Wasser herbeischleppen. So wie ich mich kannte, würde ich ohnehin komplett durch den Wind sein – Jacky hatte nämlich zu allem Übel darauf bestanden, dass ich dabei wäre! Wenn das bloß gut ging.
Als sie mich in ihrem gedankenverlorenen Tun endlich bemerkte, saß ich schon vor ihr und strich ihr sanft über den Bauch, in dem unser Kind heranwuchs. An diesem Abend, den wir nach gut einer Woche endlich wieder in Zweisamkeit verbringen konnten, schickte ich wieder einmal stille Gebete zum Klabautermann, auf dass er mich bei den bevorstehenden Kampfhandlungen lebend und gesund nach Hause brachte.
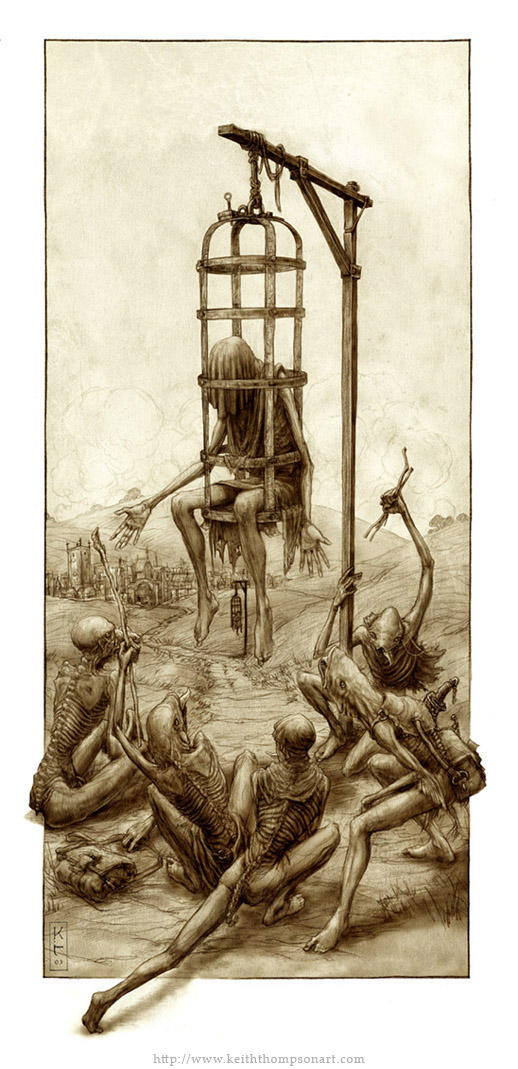
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 04 Aug 2010 17:37 Titel: Verfasst am: 04 Aug 2010 17:37 Titel: |
|
|
Episode 22 – Saufen unter Söldnern
27. Cirmiasum 253
In Düstersee
Eine schlichte Meldung von einem meiner Agenten hatte mich an diesem frühen Nachmittag dazu veranlasst, meine Wache an einen der Maate abzugeben. Der Mann, ein Sattler, der in dem rahalischen Lehen Düstersee heimisch war, hatte uns über einen Fischer die Kunde bringen lassen, dass sich in dem Ort etwas zusammenbraue. Was es auch immer war, es war von einer Tragweite, die meinen Agenten dazu veranlasst hatte, in der Eile sogar die übliche Chiffrierung zu vergessen. Ein Lapsus, der den Sympathisanten der Bruderschaft besonders am Anfang manchmal geschah, wenn sie unter Druck standen. Jener rahalische Bürger war uns sein Leben schuldig, weswegen er nun für uns arbeitete. Kein Anhänger aus Überzeugung, was grundsätzlich zu bevorzugen war, jedoch ein Mensch, der wusste, wem er Dank zuschulden hatte – und wem nicht.
Jedenfalls hatte ich den 1. Maat Gracia kontaktiert und wir beschlossen kurzerhand, uns selbst ein Bild von der Lage im Süden des Alatarischen Reiches zu machen. Schon während wir uns mit meinem kleinen Schoner, der uns schon so manches Mal gute Dienste geleistet hatte – man entsinne sich nur der Befreiung Kimroths aus der Adoraner Gefangenschaft – den Gestanden Düstersees auf weniger als eine Seemeile genähert hatten, wuchs die Skepsis in uns: War da nicht Rauch, der empor stieg? Mitten im Hochsommer wurden die Kamine selten betrieben, war dort ein Brand ausgebrochen? Wir wären nicht Teil von Pereras Pack gewesen, hätten wir diese Zweifel nicht zum Anlass genommen, unsere Waffen zu überprüfen und schussbereit zu machen. Wer konnte schon wissen, was genau dort vorgefallen war…
Kaum waren wir angelandet und hatten den Kahn vertäut, eilten wir zum Nord-Tor der kommoden Ortschaft. Keine Wachen. Das war seltsam und schärfte unsere Sinne, wachsam zu sein. Irgendetwas war hier faul, zumal sämtliche Wimpel des Reiches und der Serya...Ser... na, der Blaublüterin, die mit der Ortschaft belehnt war, fehlten. So schlichen wir wachsam und vorsichtig durch die Gassen, bis wir auf einige Bewaffnete trafen, die auf Patrouille schienen. Rasch hatten wir uns in den engen Gässchen, die zwischen den Häusern lagen im Dunkel verborgen und eilten weiter, als die Patrouille vorüber war. Schwarz lackiertes Rüstzeug, rotes Wehrgehänge – wenn mich nicht alles getäuscht hatte, waren es Soldaten Rahals gewesen. Wie falsch ich damit lag, sollten wir bald erfahren. Unser Weg führte uns an verlassenen oder verrammelten Häusern vorbei, hier und da brach schwaches Licht durch Spalten oder Ritzen. Nur auf den Straßen, da waren wir allein. Einmal abgesehen von den Bewaffneten, auf die wir auch weiterhin trafen und es vorzogen, ihnen auszuweichen. Ich musste unbedingt zu unserem Mann in der Ortschaft gelangen, doch den Weg dorthin konnten wir nicht mehr zu Ende bringen; es war eine Dolchklinge, geführt von einer kurzhaarigen, bis an die Zähne bewaffneten Frau, die an der Kehle des Maats dafür sorgte. Das Weib war auf einmal hinter einer Ecke hervorgeprescht und hatte Gracia in diese missliche Lage gebracht, ohne, dass der Maat etwas hätte dagegen tun können. Freilich hob ich sofort meine Muskete und legte auf den Schädel der Angreiferin an, doch mir war klar, dass ich bei dem schlechten Schussfeld nicht abdrücken würde – das Leben von Gracia war ich nicht bereit, zu riskieren. Also visierte ich sie an, ließ sie drohen und keifen, starren und fuchteln… und umkreiste sie indes langsam, ohne auch nur den Zeigefinger vom Abzug zu nehmen. Noch ein paar Schritt, und ich hätte einen guten Schusswinkel… da rammte Gracia der Frau mit Ellbogen und Knien die Luft aus dem Leib und sicherlich Schwärze vor die Augen – denn die Angreiferin ließ gepeinigt von dem Maat ab, so dass meine Kameradin an mir vorbei in Sicherheit spurten konnte. Im selben Moment, da sie an mir vorbei und das Schussfeld frei war, drückte ich ab. Als der Pulverdampf sich lichtete, sah ich, dass die Angreiferin auf wundersame Weise der Kugel auf kaum drei oder vier Metern Distanz entwischt war. Oder hatte ich vergessen, ein Projektil zu laden? Bei allen Dublonen, das war nun auch gleichgültig, denn der Lärm des Schusses rief die Kameraden der Frau auf den Plan, die jetzt die Gasse vom Wirtshaus herauf gestürmt kamen, also gingen wir hinter der nächsten Mauer in Deckung. Ich lud so schnell ich konnte meine Muskete, Gracia machte ihre Pistole bereit. Jetzt würde es hässlich werden.
Gerade war meine Muskete wieder schussbereit, da hatte sich die Gruppe der unbekannten Angreifer gesammelt und abgesprochen, den sie gingen koordiniert und schnell vor und hatten uns, die wir nur zu zweit waren, rasch eingekesselt. Wenn es einen Moment in meinem Leben gegeben hat, da ich mir nicht sicher war, lebend aus einer Sache herauszukommen, so war es diese Einkesselung. Selbstredend hatten wir vor, es diesen Bastarden nicht leichtzumachen und so viele von ihnen mitzunehmen, wie es nur ging. Und zuerst würde es dieses junge Ding sein, das meiner Kameradin den Dolch an die Kehle gehalten hatte!
Der Klabautermann meinte es allerdings heute gut mit uns, denn anstatt, dass uns diese Landratten unseren mit ziemlicher Sicherheit letzten Kampf boten, luden sie uns auf einen Umtrunk in „ihre“ Taverne ein. Zögerlich, die Waffen auch weiterhin griffbereit, ließen wir uns auf diesen Vorschlag ein. Es war immer noch besser den Abend mit Rum begehen, als mit vielen Toten. Auch, wenn ich mir auf dem Weg zur Spelunke den Kopf zerbrach, wie ich am besten um’s Trinken herumkam, hatte ich diesem Laster doch hoch und heilig für die Dauer von Jackys Schwangerschaft abgeschworen. Ganz herum um einen Gelübde-Bruch kam ich leider nicht – zum Zeichen des guten Willens floss Zwergenbier meine Kehle diesen Abend hinab, den ich unter diesem Haufen rauer Gesellen zubrachte.
Sie waren Söldner, so hatte mir ihr Boss Duncan während des Umtrunks erzählt, und sie hätten Düstersee überfallen, um ihre Vorräte aufzufüllen und ihren Spaß zu haben. Welcher Art dieser Spaß sein würde, wurde mir durch seine Mimik und Gestik, als auch das Gehabe seiner Leute mehr als deutlich. Ich war also froh, als Gracia verfrüht zu unserem Schiff zurückkehrte (ihr hatte so mancher dieses Packs mehr als nur lasziv nachgesehen und sie mit Blicken förmlich ausgezogen) und nahm mir vor, bei der Düsterseer Schneiderin Nedleyne, mit der ich mich angefreundet hatte, nach dem Rechten zu sehen. Für den Moment beließ ich es beim Fragen und Zuhören, um so viel wie nur möglich in Erfahrung zu bringen. Hilfreich war dabei das Wirken des Vogelfreien Melcher – „Blondie“ – der zwischen Rahal und den Söldnern vermitteln sollte. Dem Vogelfreien und mir war klar, dass dieser bunte Haufen von vielleicht fünfzig Männern und Frauen, so kampferprobt manche von ihnen sein mochten, nur den Tod durch das rahalische Heer erwarten konnte, wenn sie Glück hatten und nicht in die Hände der Blauhäute fielen. Duncan und seine Jungs sahen das wohl nicht ganz so realistisch, denn sie hatten einen Ritter Alatars in die Flucht geschlagen und waren seitdem der Meinung, Rahals Militär schnupfen zu können. Welche Narren!
Als ich mich schließlich verabschiedete, hatte ich meine Saat gesät: Vielleicht, so hatte ich durchblicken lassen, würden wir, die Piraten, ihnen Hilfe in Form des Ausschiffens zukommen lassen, würden sie in Bedrängung geraten. Das war natürlich nur die halbe Wahrheit. Rahal war im Moment unser Verbündeter, wenn man es denn so nennen wollte, und somit würden es eher unsere Drachenrohre sein, die dieses Söldnerpack erwarten konnte, denn unsere Hilfe. Doch das Schicksal dieser Meute musste erst im Rat der Bruderschaft entschieden werden.
Nur eines war klar, diese Söldnerin, die Gracia attackiert hatte, würden wir uns vornehmen und ein Exempel statuieren, das mit Kielholen und Ersäufen eng verknüpft sein sollte.

_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 22 Aug 2010 13:41 Titel: Episode 23 – Amme wider Willen Verfasst am: 22 Aug 2010 13:41 Titel: Episode 23 – Amme wider Willen |
|
|
Episode 23 – Amme wider Willen
13. Ahatar 253
Im Rahaler Hafenviertel und in Berchgard
Zünfte waren streng zu ihren eigenen Leuten und ihrer Kundschaft. Streng bei der Auswahl jener, bei der Preisgestaltung, Ausbildung… überhaupt. Der Handwerker, der alleine sein Glück im Reich versuchte, der hatte mit dieser Größe zu rechnen. Erst heute Nachmittag, als wir bei Wilderich zu Besuch gewesen sind, hatte er über diese schwierige Lage lamentiert – er, der er für den Bund und Eigenerwerb eine Schmiede in Berchgard führte, konnte sich gerade so mit seiner Stammkundschaft über Wasser halten. Auch ich konnte ein Lied von den Marotten der Zünfte singen, wurde ich doch vor einiger Zeit einmal aus dem Handelshaus von Gerimor verwiesen, da man meinesgleichen nicht trauen würde – sie mochten Seeleute im Allgemeinen offenbar nicht. Aus diesem Grunde hatte ich vor zwei Tagen meinem Bruder einen Besuch abgestattet, reichstreu wie er war damit beschäftigt, seinen Wachdienst beim Hause Hohenfels zu absolvieren. Er nahm seine Leibwächter-Arbeit sehr ernst, weswegen ich mich einer List bediente, um ihn aus dem vermaledeiten Anwesen zu locken und ihn Ruhe mit ihm reden zu können. Das Anwesen stand und steht auch heute noch gegenüber des Adoraner Spitals, in dem unter anderem Liliana Kranken und Verletzten half. Oder eben.. Armen. Für jene war am Südende des Gebäudes eine Armenspeisung eingerichtet worden, offenbar die Art der Adoraner Blaublüter, ihr Gewissen zu beruhigen, wenn sie wie Götter dinierten und unterdessen der gemeine Bettler in der Gosse verrottete. Zu diesem Zwecke befand sich dort eine Kochstelle über offenem Feuer, daneben Sitzmöglichkeiten für die Bittsteller – das übliche Gericht war ein Eintopf aus allem, was erübrigt werden konnte. Genauer gesagt – es war besser, die Bestandteile nicht zu hinterfragen, sondern einfach nur zu essen. Und eben das tat ich. Bedürftig war ich zwar nicht, um das Blut meines Bruders vor Zorn in Wallung zu bringen sollte es indes genügen. Tatsächlich stürmte Ilbert schon bald, nachdem ich den Teller zur Hälfte geleert hatte, aus dem Tor des Anwesens und stellte mich, meine Dreistigkeit anzuprangern – wie könnte ich denn den Armen ihre Nahrung stehlen? Für einen Rechtschaffenen wie ihn war das freilich unerklärlich und schwierig – was mich anging… was war schon dabei? Während er mich mit schroffen Worten mit sich fort, etwas weg vom Anwesen nahm, wandelte sich sein Zorn spätestens ab dem Moment, da ich nun weiterhin unbekümmert essend vor ihm stand zu Resignation. Ändern konnte er mich ja doch nicht. Einen Gefallen tun hingegen schon: Vor einiger Zeit hatte ich ihn darum gebeten, mir ein Paar Ringe für Jacky und mich zu besorgen, allein aus dem Grunde, den ich eingangs bezüglich der Zünfte angerissen habe. Nur ein beglaubigter, mit Gewährsleuten ausgestatteter Reichsbürger wie Ilbert konnte für mich die qualitätsvollen Dienste der königstreuen Zunft in Berchgard in Anspruch nehmen. Das war schließlich das mindeste; wenn meine Gefährtin und ich schon den Bund eingingen, dann mit den schönsten Ringen, die die Insel zu bieten wusste. Nach dem Stand der Dinge wollte ich mich an jenem Tag bei ihm erkundigen, hatte darüber völlig vergessen, dass er die Ringe schlicht noch nicht kaufen konnte, weil wir die weiteren Umstände noch gar nicht abgesprochen hatten. Das holten wir jetzt nach, eilig und knapp, denn Ilbert war schon ganz hibbelig und genervt, denn er wollte nicht von seinen Herren mit seinem „missratenen“ älteren Bruder gesehen werden. Die Ringe sollten, entgegen der gängigen Tradition, aus Silber gefertigt werden. Dieses Material mochte Jacky lieber als Gold, zudem wehrte Silber Untote ab – Schönheit und Nutzen in einem, was mir abergläubischem Mensch auch sehr taugte. Also sollten sie aus Silber sein, was mein Bruder nörgelnd zur Kenntnis nahm. Eine andere Tradition wollten wir nicht in den Wind schlagen, nämlich das Beschriften der Ringe: Hierbei überraschte mich Ilbert, indem er sogar einen Vorschlag vorbrachte, der mir so gut gefiel, dass ich ihn sogleich übernahm. Die Ringe sollten einen zusammenhängenden Text erhalten, der erst Sinn machte, wenn die Ringe vereint wären.
„Ein sicherer Hafen…“ – „… in stürmischer See.“

Ilbert schien überhaupt heute seinen hellen Tag zu haben, denn sein nächster Vorschlag, den er zum Besten gab war erneut sehr gefällig. Es war schon irrig – einerseits mochte er mich nicht sonderlich, was auf Gegenseitigkeit beruhte, andererseits half er mir manchmal nach Leibeskräften. Familienbande waren nun einmal doch stärker, als Recht und Justiz.
Jedenfalls schlug er mir vor, noch einen weiteren Ring für das Kind in Auftrag zu geben, zum einen als Zeichen dafür, dass es zu uns gehörte, zum anderen als Wertanlage für seine Zukunft. Das erschien mir einleuchtend und so waren es am Ende drei Ringe, derentwegen mein Bruder für mich zum Handwerkshaus gehen sollte.
Bisher hatte ich noch keine Neuigkeiten von Ilbert vernommen, hoffte aber, dass die Ringe bald fertig wären – Jacky würde wahrscheinlich in absehbarer Bälde gebären. Danach wollten wir die Trauung von meinem Käptn vollziehen lassen, dementsprechend wollte ich die Ringe besser früher als später vollendet wissen. So wie schon Vallas und Charly, als auch so manch andere Kameraden trachtete ich danach, unsere Hochzeit an Bord der Toro de Muerte zu feiern, mit dem Segen meines Käptns Perera und feucht-fröhlichem Zechen mit meinen Kameraden. Wir würden endlich wieder ordentlich saufen und es krachen lassen können… mit solchen Gedanken im Kopf saß ich auf dem Flachdach, das unserer Bude den Namen gegeben hatte, nahm die Eindrücke des Hafenviertels in mich auf, wie schon so oft. Schon bald würde das Krähennest nur noch zweite Landheimat sein, wenn erst der Vulkan auf Cabeza ruhte und wir den Neuaufbau unseres Stützpunkts hinter uns hatten. Für meine bald dreiköpfige Familie hatte ich ein zweistöckiges, beschauliches Häuschen im Sinn, an der cabezainischen Bucht, nahe dem tiefen, beschaulichen Urwald, der unserer Insel dieses schöne Grün schenkte. Die warme, über das ganze Jahr scheinende Sonne und das tropisch-herrliche Klima würden Jacky sicherlich gefallen – bei dem Gedanken lächelte ich sanft. Da sah ich eine mir wohlbekannte Frau vor dem Krähennest auftauchen – Jacky kehrte heim. Ich begrüßte sie winkend, ehe ich nach unten zu ihr kam, um sie in die Arme zu schließen. Ihr von der Schwangerschaft gewölbter Bauch hatte mittlerweile gehörige Ausmaße erlangt und kündete von der bald (Jacky sprach von ein bis zwei Mondläufen) anstehenden Entbindung. Ehe wir in die Bude hineingingen, eröffnete meine Gefährtin mir den Wunsch, wenigstens ein klein wenig Rum trinken zu wollen, wenn ich „Halunke“ mich doch zulaufen ließe. Zugegeben, trotz meines Versprechens hatte ich in den letzten Monden mehrmals gesoffen, mehr oder weniger unfreiwillig zwar, aber gesoffen. Zudem war die Schwangerschaft ja beinahe zu Ende und nur, weil komische Scharlatane meinten, eine Schwangere solle nichts trinken… nun ja, abergläubisch wie ich war, wollte ich natürlich auf Nummer sicher gehen: Ein Schluck könne nicht schaden. Es war indes Jacky, die der Vernunft Bahn brach und dieses Angebot in den Wind schlug. Sie wollte nichts riskieren. Nach der Schwangerschaft könne sie ordentlich bechern – aber auch da erst nach einiger Zeit. Zuerst war ich irritiert, dann ging es mir auf: Klar, Stillzeit. Jacky schien das Geschwätz der Heilkundigen tatsächlich für bare Münze zu halten, denn sie schlug vor, dass wir eine Ersatzamme bräuchten, wenn wir während der ersten Zeit nach der Entbindung saufen gehen wollten. Doch woher eine Amme nehmen, die selbst erst ein Kind bekommen hatte und beide stillen konnte?
Jackys Vorschlag ließ mich beinah in lautes Gelächter ausbrechen: Kiebitz, Ionna. Und denjenigen, der sie rasch schwängern sollte hatte sie auch schon parat: Meinen Matrosen Levi!
Potzblitz, bei allen Dublonen – was Levi anging, den könnte man vielleicht dafür erwärmen, ich meine.. Frau war Frau… doch bei Kiebitz sah ich schwarz. Die wollte andauernd ihre Schwester Iri verkuppeln, selbst war sie allerdings ziemlich renitent in Bezug auf Beziehungen. Jacky ließ sich nicht von dieser Wahl abbringen – als ich zum Beispiel Verdania vorschlug, die ja erst vor kurzem ein Kind bekommen hatte, verneinte sie entschieden. Ich wisse ja gar nicht, so meinte sie, was man alles über die Muttermilch aufnehme… Unarten! Sie wollte keine Gutbürgerliche, nicht, dass unser Kind dazu mutieren würde. – Das war selbst für mich harter abergläubischer Tobak. Aber gut, ich hatte davon ja keine Ahnung und sagte das auch gleichmütig zu ihr. Frauensachen. Hellhörig geworden rief mir Jacky in dem Moment in Erinnerung, dass sie mir das schon alles beibringen würde, schließlich würde ich ja bei der Entbindung dabei sein! Ich schauerte innerlich und sah mich forschend in der Gasse um, die Mannschaft hatte Landgang, nicht auszudenken, wenn die Matrosen Wind davon bekamen. Der Bootsmann eine Hebamme! Seeleute konnten da sehr unleidlich sein und mir erschien es wenig reizvoll, erführen meine Schutzbefohlenen davon.
Sei’s drum, jedenfalls zogen wir etwas später in Richtung Kiebitz Laden, um sie mit der Idee zu konfrontieren. Wir gingen es langsam an. Ionna wisse ja, dass bald ihr Tanten-Dasein beginnen würde (wir hatten sie dafür gewonnen, ab und an auf den Brösel aufzupassen, wenn er erst auf der Welt wäre) und wir da einen Vorschlag hätten, völlig kostenlos, bei dem sie sogar noch „etwas“ gewinnen würde. Blauäugig wie sie war, sagte Kiebitz Ja. Freudestrahlend klatschte meine gerissene Gefährtin in die Hände, während ich mich polternd erhob, und Kiebitz dazu aufforderte, „es“ mit einem Handschlag zu besiegeln. Diese fragte verdattert, ob sie etwa ihre Seele verkauft hätte und schlug sehr, sehr, sehr zögerlich ein. Erleichtert ließen wir uns wieder in die Stühle plumpsen – der leichte Teil war erledigt. Jetzt folgte der schwierige. Es fiel mir zu, Kiebitz zu eröffnen, dass wir, die wir saufen wollten, ein Problem hatten. Jacky könne als junge Mutter dann nicht so viel trinken, wie sie gerne wollte, weswegen wir eine Amme bräuchten… da ging Ionna ein Licht auf und sie protestierte heftig. Sie wolle den Kleinen nur gelegentlich und kurzzeitig! Ich lächelte in mich hinein, glich würde die Bombe platzen: Iwo, sie müsse ihn doch nur stillen.
Stille.
Dann brach die Hölle über uns herein.
Nach einigen Tiraden wurde uns klar: Die Kiebitz würden wir ums Verrecken nicht dazu bekommen, sich vom levi schwängern zu lassen und für uns Amme zu spielen. Ausweichplan!
Jener war dergestalt, dass Jacky eine Apparatur im Sinn hatte, ähnlich einer Pumpe, um sozusagen auf Vorrat Milch abzufüllen. Die Kleingaunerin kam schon auf skurrile Ideen. Ich warf ein, dass wir an Bord Pumpen zum lenzen der Bilge verwenden würden – für filigranere Zwecke warne die aber nicht zu gebrauchen. Also kam man letztlich überein, Schröpfkugeln auszuprobieren, es wäre zwar nicht allzu effektiv, könnte aber klappen. Kiebitz war damit zufrieden, weiterhin nur als Tante zu fungieren und wir besuchten in den Tagen danach den Schmied der Elstern, Wilderich in Berchgard.
Er würde versuchen, solche Kugeln zu blasen – ausprobieren müssten wir sie dann freilich selbst. Sofern sie ihm denn gelängen, ich war kein Handwerker, konnte mir jedoch vorstellen, dass es sicher nicht leicht war, Glas in solche zum einen filigranen, zum anderen höchststabilen Kugeln zu verarbeiten. Doch Wilderich war sicher fest im Glauben an Cirmias, dem Handwerks Gott… man sagt, wer an Cirmias glaubt, der könne vortreffliches im Handwerk vollbringen, manche Handwerker träumten von dem Geheimnis der Unzerstörbarkeit.
Ich hingegen träumte dieser Tage von Jacky und unserem Kind, das sie trug.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 10 Okt 2010 20:58 Titel: Episode 24 – Von kleinen und großen Piraten Verfasst am: 10 Okt 2010 20:58 Titel: Episode 24 – Von kleinen und großen Piraten |
|
|
Episode 24 – Von kleinen und großen Piraten
11. Searum 253
Im Rahaler Hafenviertel und in Bajard
Die lange Zeit der Abstinenz war vorüber und es gab etwas zu feiern!
Ich glaube, dass mich der allgemeine Gemütstaumel, in dem ich mich dieser Tage befunden dazu bewegt hatte, mitten in der Nacht das Krähennest in Rahal zu verlassen und mit meinem Kahn nach Bajard zu tuckern. Es war schon verrückt genug in der Nacht an der Küste entlang zu schippern – ohne Schmuggelware! Aber was sein musste, das musste nun einmal sein.
Schließlich fand ich dort auch das, was ich gesucht.
Nachdem ich meinen Kahn an der kleinen, unscheinbaren Mole vertäut hatte, die der Bruderschaft als Schmuggelplatz in Südgerimor diente, führten mich meine Schritte zielstrebig durch die dusteren schlammigen Gassen des Fischerdorfs zu dem einzigen Ort, der zu der späten Abendstunde (es war sicherlich zwei Glasen vor der Hundswache) noch beleuchtet war. Die Dorfspelunke, in der das Leben tobte.
…
Oder sagen wir besser soff.
Mein Bruder gehörte auch dazu.
Bei meiner Ankunft saß er gerade ins Gespräch mit einer ziemlich mitgenommen aussehenden hellen Frau bei Tisch. Ich trat direkt zu ihm heran und ließ mich mit einem saloppen Gruß neben den beiden am Kopfende des Tischs nieder, kam ich doch nicht umhin, meinen kleinen Bruder durch das ungestüme Verhalten aufzubringen. Meistens gelang es auch, dieses Mal allerdings nicht so Recht, wie es sollte. So stellte Ilbert mir seine Tischgesellschaft als Selene vor und sie war tatsächlich äußerst hell, ja blass und ihre Augen seltsam rötlich. Diesen Menschenschlag kannte ich von meinen Fahrten und es wunderte mich ehrlich gesagt, derartiges hier in Gerimor zu sehen, hatte ich ihn während meiner Zeit vor der Seefahrt nie hier angetroffen. Es musste eine obskure Laune der Götter sein und so berührte ich unwillkürlich, auf Diskretion bedacht, mein Amulett. Man konnte ja nie wissen, welch Unheil in solchen bleichen Wesen ruhte. Ich vermochte mich nicht weiter der Musterung Selenes zu widmen, denn ein Mann holte sie von uns fort, offenkundig ging es um ihre Behandlung – sie sah mitgenommen aus, was mir Ilbert daraufhin auch erläuterte. Ein Opfer der Raben, der geisteskranken Anbeter des Leichengottes, mit denen ich und meine Freundin Nedleyne schon das ein und andere Mal Bekanntschaft gemacht hatten. Schaurige, bis auf die Knochen gefährliche, böse Kreaturen. Mein Bruder war selbst mit hinein geraten, denn er wirkte abgedroschen und müde, woraus ich schloss, dass er mit den fremdartigen Geisteskräften dieser Suche Bekanntschaft gemacht haben musste.
Kurzer Rede, kurzer Sinn: Als wir nur noch zu zweit waren, begannen wir zu saufen, aus jeweils eigenen Antrieben.
Was meinen Bruder betraf, so war er bereits angetrunken und so währte es nicht lang, bis er zum ersten Mal mit dme Kopf auf den Tisch hinab donnerte und sinnloses Zeug von sich gab. Da musste ich auch zweimal die Spitze mit dem „Onkel“ anbringen, bis er endlich gerafft hatte, dass er nun einen Neffen hatte, sein lieber Bruder und Krimineller Vater wäre.
Ho – und dann soffen wir erst Recht!
Ich kann nur vermuten, dass wir den wildesten Mist fabriziert haben, irgendetwas, was mit Familien, Anschaffen, Frauen und Ilberts Versuchen, mit der Stirn den Tisch zu durchschlagen zu tun hatte.

Jedenfalls erwachte ich tags darauf vollkommen zu gedröhnt, mit schweren Gliedern, schmerzendem Kopf und fahlem Geschmack im Mund im Bauch meines Kahns. Wenigstens hatte ich es wohl im Vollsuff geschafft, nicht in, sondern aus meinem Kutter heraus zu kotzen, denn es tummelten sich verdächtig viele kleine Fische um den Rumpf herum. Einen positiven Nebeneffekt hatte dieser Umstand: Wenig später saß ich mit einem fischhaltigen Frühstück am Ufer und ließ mir von unserem Verbindungsmann in Bajard einen Sud aufsetzen, der gegen den Kater helfen sollte.
Der Grund für den Absturz war ein äußerst erfreulicher, trat am 06. Searum in mein Leben und hieß Esteban Noa Sylva.
Mein Sohn.
Der Sohn von einem Piraten und einer Kleingaunerin, die dem Seemann gezeigt hat, dass auch Landratten ernst genommen werden konnten. Und weit mehr noch: Dem Seemann, der ein abenteuerliches Leben führte, einen sicheren Hafen bieten konnte, der Ruhe und Frieden in einer kriegerischen Welt versprach.
Und unser kleiner Brösel sollte ein ganz Großer werden, das war Jacky und mir jetzt schon klar.
Ein stattlicher Pirat, der dem Erbe Pereras alle Ehre machen… ein Krimineller, der den gepuderten Schnallenschuhträgern der Großreiche das Fürchten lehren würde.
Ein echter Sylva!

_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II
Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 10 Okt 2010 21:01, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 17 Dez 2010 02:41 Titel: Episode 25 – Unverhofft kommt oft Verfasst am: 17 Dez 2010 02:41 Titel: Episode 25 – Unverhofft kommt oft |
|
|
Episode 25 – Unverhofft kommt oft
16. Alatner 253
Im Rahaler Hafenviertel, in Bajard und auf Lameriast
Es waren mittlerweile schon mehr als vier Mondläufe, seitdem der kleine Esteban in unser Leben getreten war. Jacky und ich waren froh, ihn wachsen zu sehen, wie er mehr und mehr Ähnlichkeit mit unseren Gesichtszügen bekam. Und natürlich kosteten wir es aus, dass wir endlich wieder gemeinsam Saufen gehen, Spelunken auf ganz Gerimor unsicher machen konnten! Oft war Esteban mit dabei an vorderster Front, konnte einen Eindruck davon gewinnen, was es hieß, einen echten Spelunkenabend zu erleben! Zur Beruhigung aller Leser, die nun empört aufschreien – selbstredend gaben wir dem Kleinkind nie Alkohol. Abgesehen von meinen kleinen Grog-Dreingaben auf die Lippen, von denen ich nicht abließ und heute nicht ablassen würde. Jacky folgte indes der Ansicht vieler Bürgerlicher – man stelle sich das vor, im Einklang mit Heiler-Meinungen, Jacky! Meine Jack! – und wollte keinen Tropfen Grogs oder Rums an unserem Kind sehen. Dafür aber… Met.
Aye, echten Honigwein, wie ihn die Tiefländer gallonenweise trinken! Die Thyren würden angeblich ihren Kindern mit Met versetzte Milch geben, das mache sie stark und kräftig. Ob da was dran war, wage ich zu bezweifeln, doch wenn es ihr so viel bedeutete – wieso eigentlich nicht?
Aus diesem Grunde waren wir heute aus Bajard nach Lameriast aufgebrochen. Eigentlich hatten wir vorgehabt, uns ordentlich zu besaufen, doch nach einigen Flaschen Bier und Wein, gefolgt von heißem Grog hatte sich immer noch nicht die gewünschte Wirkung ausgebreitet, so dass wir relativ klaren Geistes meine den kleinen Esteban behütende Cousine empfangen konnten.
Cousine. Richtig gehört.

Noemi Sylva hieß die Gute, aus derselben Linie wie meine Mutter und doch so verschieden. Während ich nur unter der strengen Knute von Vater und Onkel Hauslehrer und Kaufmannslehre erdulden musste, bis es mir endlich gelang, auszubrechen, musste sie ihre zarten 16 Jahre lang sinnlos die Tiraden ihres Vaters, meines Onkels, erleiden. Während ich lernte, das war immerhin etwas, und nur, wenn ich faul war oder Verbote missachtete Prügel kassierte, traf Noemi der Jähzorn ihres Vaters sinnlos. Im Suff, aus Langeweile oder schlicht zum persönlichen Amüsement. Oft genug hatte ich sie davor bewahren können, mehr als einmal habe ich selbst dafür Hiebe kassiert und es doch nie bereut. Und, so wahr das schwarze Schiff verflucht war, so würde ich ihn einstmals heimsuchen und für alles zahlen lassen, was er getan. Vor so vielen Jahren hatte ich sie zurückgelassen, war nach meiner Kaufmannslehre des Familienunternehmens und der harten Knute auf See geflohen, bin als Matrose auf einem Handelsschiff zur See gefahren. Dieses Schiff hatte wie so viele andere seiner Sorte ein Schicksal ereilt, das für mich alles geändert hatte. Ein Piratenüberfall hatte mir ein neues Leben eröffnet, während meine Familie mich seitdem, offizieller Meinung folgend, für genauso tot hielt wie den Rest der Schiffsbesatzung. Nur mein Bruder Ilbert, der einzige aus meiner Familie, der nach der Zerstörung Varunas auf Gerimor geblieben war, wusste um die Wahrheit. Selbstredend schwieg er sich darüber aus, als Leibwächter eines bedeutenden Adelshauses machte es sich nicht gut, einen Piraten als älteren Bruder zu haben. Entgegen unseres schwierigen Verhältnisses in der Kindheit hatten wir auf Grund dieses besonderen Umstands sogar zu einer Form von stillschweigender Übereinkunft gefunden. Letztlich hatten wir ja nur uns beide auf Gerimor, betrachtete man es einmal von familiärer Seite; denn merkwürdigerweise war er auch der einzige nahe Angehörige, bei dem ich sogar frohgemut den vollzogenen Bruch unterband. Ich war glücklich so, wie ich mit meinen Kameraden, Ilbert und meiner kleinen Familie lebte. Doch so etwas konnte ja nicht ewig währen – und so war Noemi jüngst aufgetaucht!
So oft ich auch in jungen Jahren Partei ergriffen hatte, ehedem ich der Familie floh, war es mir jetzt zuwider, sie um mich zu wissen. Also wird sich der geneigte Leser vorstellen können, dass sich meine Hochstimmung in bescheidenen Grenzen hielt, als ich meine Cousine in dem Mädchen zu erkennen glaubte, das meinem Kameraden Vallas in der Rahaler Hafenspelunke gegenübersaß. Eben jener Spelunke, die ich an diesem Tag mit reichem Umtrunk beehren wollte. Wohl gemerkt in Ruhe und Frieden. Besonders mit letzterem war es ab dem Moment erst einmal vorbei: Kaum, dass sie mich erkannt und zuerst kreidebleich, dann puterrot geworden war, hatte sie mir eine gehörige Backpfeife verpasst, dass mir der Kopf halb abfiel. Welch Schläge dieses schmächtige Mädchen doch austeilen konnte! Und ich Trottel hatte sie die ganze Zeit über verteidigt… Vallas indes fand es natürlich köstlich und eröffnete mir, dass er meine Cousine bereits kennengelernt und angeworben habe. Das war natürlich stringent, wenn einer aus der Familie Bootsmann war, dann mussten in den anderen doch auch ein Seemann schlummern – und war er noch so klein. Zu meiner Erleichterung hatte er sie nicht in dem Schwarzen Buch unterschreiben lassen, sei’s wie es sei, das hätte ich nicht gewollt. Schließlich ließ er uns beide allein, da wir ja noch genug zu erzählen hätten. Pah! Mir lag es fern, es ruhig angehen zu lassen, zumal mich Noemi auf ihre kindlich-naive Art sogleich darauf ansprach, ob ich nun tatsächlich Pirat wäre und…. Etwa ab da habe ich abgeschaltet und den Anker fallen lassen. Wie sich im folgenden Gespräch herauskristallisierte hatte sie eine etwas verklärte Ansicht von der Piraterie, wie die meisten Landratten. Mir schwante, dass sie vielleicht vorschnell gehandelt hatte. Doch was kümmerte mich das? Sie war nun auf der Liste der Schanghaiten und Anwärter, ihr Arsch gehörte nun mir, ob sie nun wollte oder nicht. Das würde ihr schon lehren, was das echte Leben fernab des „goldenen Käfigs“ unserer Familie hieß. Denn an Bordwürde ich sie mit Sicherheit die nächste Zeit nicht lassen, da hatte ich viel zu viel Angst um sämtliches bewegliches Gut an Deck! Außerdem war sie ein furchtbares Plappermaul, wie mir in den nächsten Tagen schwer bewusst wurde – hatte ich das so sehr aus meiner Vergangenheit ausgeblendet? – dass mir in so mancher Situation heiß und kalt wurde. Jüngst, es war erst am heute Früh gewesen, als wir (Jacky, Esteban, Noemi und ich) in der Taverne in Bajard saßen und Grog süffelten, dass sie mich ohne Umschweife und klar für alle Umstehenden verständlich „Jaron“‘ und „Pirat“ in einem Atemzug nannte! Jacky wäre fast der Kragen geplatzt, insbesondere, nachdem sie wieder einmal vorgebracht hatte, mich zu verpfeifen. Das klingt nun sehr harsch, als wäre sie eine miese Verräterin, doch zu ihrer Verteidigung muss ich anfügen, dass ich seit ihrer Ankunft nicht sonderlich nett zu ihr gewesen bin. In ihrem kindlich-naiven Charakter, war sie doch noch ein halbes Kind, sah sie eben wohl nur ihr Heil in der Offensive. Ohne nachzudenken, was es wirklich für Folgen gehabt hätte. Nachdem wir ihr in sehr deutlichen Worten klar gemacht hatten, dass die unbedingte Folge mein und vielleicht sogar ihrer und Jackys Tod am Galgen gewesen wären, hatte sie endlich begriffen. Es blieb abzuwarten, ob sie mich künftig brav „Lys“, „Lysander“ oder meinetwegen sogar „Lissy“ nannte, nicht den Piraten, sondern den Walfänger.
Am selben Tage machten wir uns auf den Weg nach Lameriast.
So kalt es auf Gerimor war, auf der dünn besiedelten Insel mit ihrer weitläufigen Wildnis war es noch viel kälter. Wie die Tiefländer hier dauerhaft leben konnten war mir, der ich als Cabezianer die tropische Dauerwärme schon verinnerlicht hatte unbegreiflich. Unsere Mission erlaubte jedoch kein Zaudern: Wir brauchten besagten Honigwein, Met von den Thyren, wie es unserem Sohn nur gut täte. Den hatten wir auch gleich mitgenommen, das heißt, Jacky hatte ihn mir zum Tragen aufgehalst. Findig wie ich war, hatte er zuoberst in meiner großen Umhängetasche Platz gefunden, dick eingepackt wie er war und friedlich schlafend. Mich dünkt, das Schwingen meiner Schritte erinnerte ihn an das Schwenken des Schiffs, da er nahezu so fest schlief, wie er es dort zu tun pflegte. Vielleicht ist das aber auch nur alberne Augenwischerei und ich werde langsam närrisch.
Unsere Reise blieb letzten Endes leider erfolglos, da vor den Pforten des Thyrendorfes nicht einmal ein anrufbarer Wachposten anzutreffen war, nach gut einer Stunde des Wartens bei Lagerfeuer, Rum und Lehm-Backfisch zogen wir unverrichteter Dinge wieder ab. Während Jacky zurück bleib und sich noch umschauen wollte, sie mochte nicht so leicht aufgeben, machte ich mich auf den Heimweg, um unseren Sohn ins Warme zu bringen – und, insgeheim, war auch ich heilfroh, als wir endlich vor dem Kamin im Krähennest lagerten.
Dort hatten meine Gefährtin und ich erst vor kurzem unsere gemeinsame Zukunft besprochen. Auf La Cabeza war der Vulkan erloschen und es war damit zu rechnen, dass wir um den Jahreswechsel herum heimkehren könnten. Zwar war das Ausmaß der Zerstörungen noch unklar, doch war sicher, dass ich mir mit meiner kleinen Familie ein zweistöckiges Häuschen in der Hafensiedlung nehmen würde. Das stand mir als Bootsmann und Familienvater ohnedies zu. Also vermochten wir, dahingehend schon Pläne zu schmieden; Jacky würde im Erdgeschoß ein kleines Badehaus ihrer Couleur einrichten, dazu kämen Wasserpfeifen mit meinem Kraut… es würden sich sicherlich genug Kameraden und andere Gauner finden, die den ein oder anderen Groschen für derartige Entspannung springen lassen würden. Im Obergeschoß würden unsere Wohnräume unterkommen, so wie ich uns kannte im Endeffekt wohl ein größeres Krähennest. Über das Schicksal desselbigen waren wir uns noch im Unklaren, wollten wir es behalten oder abstoßen? Das würde sich dann ergeben, wenn es so weit war – eines war jedenfalls sicher: Wir beide verbanden viele, wichtige Erinnerungen mit dieser liebenswürdigen kleinen Hütte.
Viele weitere würden in unserem baldigen neuen Heim folgen, so es die Seegeister wollten.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 20 Jan 2011 19:52 Titel: Episode 26 – Heim, trautes Heim… Verfasst am: 20 Jan 2011 19:52 Titel: Episode 26 – Heim, trautes Heim… |
|
|
Episode 26 – Heim, trautes Heim…
19. Hartung 254
Auf La Cabeza
Zwölf Tage.
Seit zwölf Tagen war ich endlich wieder in meiner Wahlheimat La Cabeza, die ich so lange hatte missen müssen. Oh, und welch wunderbarer Anblick sie doch war! Der Vulkanausbruch hatte den größtenteils unbesiedelten Norden der Insel verwüstet und der Regenwald war schon dabei, sich diese zu Asche verbrannten Areale zurückzuholen. Überall im Norden sprießte und grünte es, man mochte sogar meinen, die Nordhälfte stünde im Wettstreit mit dem Süden – als ob dieses Grün jenes Grün schlagen könnte! Der besiedelte Süden der Insel mitsamt der Bucht war verschont geblieben, wenn man einmal von adäquatem Ascheniedergang und manchen, wenigen Bebenschäden absah. Die Mole samt dem Pier, den Stegen und natürlich die erst kurz vor unserer Evakuierung endlich fertiggestellte Festung an der Buchteinfahrt standen noch, ebenso wie die meisten der Steinhäuser. Es wäre schon eine fürchterliche Sauerei gewesen, wenn die Piers draufgegangen wären. Gerade das Anlegen von denen hatte uns viele Monde und den Schweiß von hundert Mann gekostet! Spätestens jetzt waren die letzten Zweifler gegenüber dem Baustoff Vulkangestein unter den Kameraden, die einmal Steinmetzen gewesen waren verstummt – Basaltlava, wie ein paar von ihnen es nannten, eigne sich wohl doch zum Bauen. Tja, wer hätte das gedacht… mir war das Schnuppe, Hauptsache, meine Bude stand noch – und die Werft! Umgeben von hohen Kaimauern war sie als Trockendock angelegt und diente der Überholung von gekaperten Schiffen zur Eigenverwendung oder dem Weiterverkauf, immer wieder auch dem Bau von unseren eigenen, wendigen Schiffstypen. Gerade jenen hatten wir es zu verdanken, dass die Bruderschaft ihre Schmuggelaktivitäten aufrechterhalten und das Pack im Gesamten erfolgreiche Kaperfahrten machen konnte: Mit den eher schwerfälligen und langsameren Pötten der Reichsmarinen war kein Lorbeerkranz zu gewinnen. Für Seeschlachten großen Ausmaßes, behäbig und organisiert oder großangelegte Gütertransporte mochten sie sich eignen, für unsere speziellen Unterfangen, die rasche Manöver und Wendigkeit bedürften.. kaum.
Meine alte Bude ging kaum zwei Tage nach unserer Ankunft an meine Cousine Noemi. Sie würde von nun an mit einem Mitbewohner – Roberto oder Baptiste waren im Gespräch – dort wohnen. Jacky war das Haus zu duster gewesen, zu fern von der See, womit sie durchaus Recht hatte. Seinerzeit, als ich noch allein auf Cabeza wohnte, war es mir um die Nähe zur Werft gegangen, in der ich beim Landgang auf der Insel oft zu tun hatte. Als Familienvater musste man aber umdenken, also zogen wir um.
Etwas weiter im Westen, sehr zentral an der Küste der Bucht gelegen suchten wir uns in einem er größeren Steinhäuser eine passende Bleibe, unweit von Ambrosios Spelunke. Das Gebäude war ein mehrstöckiges, massives Steinhaus, dessen gesamte oberste Etage von uns vereinnahmt wurde, bot sie doch nicht nur Entfaltungsmöglichkeit, sondern auch ein neues Krähennest. Einen der zwei Balkone, die mitinbegriffen waren, wollten wir nämlich künftig als Ausguck verwenden, da er zur See hin gewandt war – unser neues „Krähennest“ war damit geboren. Weil wir nun deutlich mehr Platz hatten, als in der kleinen Hütte in Rahal sollte die eine Hälfte zum Wohnbereich werden, während die andere als Wasserpfeifen-Paradies und Badehaus deklariert wurde. So würden wir genug Wohnraum für unsere kleine dreiköpfige Familie haben und trotz allem Jackys Badetätigkeiten und meine Kraut- und Tabakmixturen an den Mann bringen können. Die ein oder andere Partie Glücksspiel inklusive. Die nächsten Tage verbrachten wir damit zu, die Besitztümer aus dem alten Krähennest vom Schiff zu laden und durch weiteres Gut zu ergänzen. Damit Esteban uns dabei nicht im Weg war, hatte sich Madame Minfay seiner angenommen, wie sie es schon bei er Heimfahrt getan hatte. So ging es zügig voran: An Mobiliar warne wir wie üblich knapp bemessen, denn wir hielten nicht viel von Tischen, Stühlen, Schränken und dem ganzen Firlefanz des Bürgertums. Kostete nur unnötig Geld! Also bestand unsere Einrichtung ganz krähennest-typisch aus haufenweise Fellen, Decken und Matten, vereinzelten alten Regalen und vielen, vielen Fässern zur Lagerung von allem und jedem. Sogar einen Kamin ließen wir uns von den Kameraden, die des Steinmetzens fähig waren ins Haus einziehen, denn was wäre das Krähennest schon ohne Kaminfeuer gewesen? Desgleichen bekam „der Dreispitz“, der uns alle Zeit an den unglücklichen Einbrecher-Geist erinnern sollte, seinen Ehrenplatz. Unsre Schlafstätte war wieder vor dem Feuer angesiedelt, ein Wust aus Bärenfellen, Wolldecken, Kissen… und Esteban hatte seine Liegstatt aus Stroh, Decken und Fellen nahebei. Allenthalben war schon nach wenigen Tagen der charakteristische Dreck vorzufinden… von der peniblen Sauberkeit, die etwa meine Cousine (zu meinem Erschrecken) an den Tag legte war uns einfach fremd. Es wurde erst wohnlich und heimelich, wenn man den Boden nur durch Holzspäne, Stofffetzen, Staub und was sonst so anfiel erblickte. Eine unumstößliche Wahrheit.
Im Zimmer gegenüber kehrte erst heute Vollständigkeit ein. Der kleine Baderaum mit Jackys Badefass und ihre Utensilien für die Spezialbäder war schon nach den ersten zwei Tagen fertig gewesen, nur der Raucher- und Glücksspielraum hatte noch auf seine letzten Ingredienzien warten müssen: Die Wasserpfeifen! Eingerichtet nach dem Vorbild er menekanischen Tavernen und Diwans durfte dieses Detail nicht fehlen. In diesem Zusammenhang erwies sich meine geschäftliche Verbindung zu einem Menekaner aus dem Hause Ifrey als sehr praktisch. Indem ich nämlich im Zuge der Bruderschaft ohnehin Geschäfte mit ihm machte, kam es mir zupass, dass er bei einem unserer Abschlüsse in Form von Wasserpfeifen bezahlte. Mehr eine private Übereinkunft zwischen uns beiden, konnte ich an dem Abend desselben Tages zufrieden mit den Wasserpfeifen heimgehen, nachdem ich einen netten Nachmittag mit dem Sandfresser und Kameraden zugebracht hatte.
Meine Cousine Noemi hatte bekanntlich einen Weinkeller zusammen mit unserem Wirt Ambrosio eröffnet.
Hoppla, wird sich da manch Leser denken, Piraten und Weinkeller?
Allerdings! Hoppla!
Aber dem geneigten Leser dürfte klar sein, dass ein halbes Kind, wie es Noemi mit ihren zarten sechzehn Lenzen war und erst seit kurzem in unserem Pack lebte, alte Gewohnheiten nicht so schnell abschütteln konnte. Und a priori ließ sich gegen Wein und seinen Genuss ja nichts einwenden – auch nicht als Pirat! Freilich, sie hatte so manch auserlesene Sorte ergattert, die man eher bei Gepuderten erwarten würde, doch daneben gab es auch haufenweise Fusel, Biere, Liköre und sogar Schnäpse. Besonders letztere hatten mir es bei dem Einweihungsbesuch, auf dem neben unserem Geschäftspartner auch Baptiste und Vallas meiner Cousine die Ehre gaben, sehr angetan. Ein Birnenobstler, um genau zu sein.
Selbstredend würden die Bestände an Rumsorten noch gehörig aufgestockt werden müssen, um den letzten Skeptiker aus dem Pack hinab in diese niedrigen Gewölbe zu locken – Jacky zum Beispiel würde Gift und Galle spucken, wenn man ihr keinen Rum bieten könnte.
Etwas Gute hatte der Weinkeller immerhin – er war auch in er brütend-schwülen Hitze La Cabezas angenehm kühl.

_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II |
|
| Nach oben » |
|
 |
Jaron Sylva

|
 Verfasst am: 01 Feb 2011 22:05 Titel: Episode 27 – Brennen und Rennen Teil 1 Verfasst am: 01 Feb 2011 22:05 Titel: Episode 27 – Brennen und Rennen Teil 1 |
|
|
Episode 27 – Brennen und Rennen Teil 1: Neugier und ihre Kehrseiten
31. Hartung 254
Auf La Cabeza
Das Brennen von Alkoholika war eine Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl und nicht weniger Erfahrung bedurfte. Erfahrung, die man meist erst mit dem Alter tatsächlich mit einem Grad erreichte, bei dem Blindheit beim Konsum der Endprodukte eine echte Seltenheit wurde.
Vergewisserte man sich nicht der Reinheit der Maische oder gab es Unstimmigkeiten in der Befeuerung der Brennblase… und das als feinstes Erzeugnis erdachte Getränk konnte ehedem zur Plörre werden. Freilich verstand ich mich nicht wirklich auf dieses Fach. Während mir Kraut und Schmuggel im Blut lagen, gab es Kameraden wie den alten Hein oder Matteo, denen das Brennen quasi in die Wiege gegeben worden war. So waren es Kameraden wie jene, die die Palette an Rum-Noten, die die Bruderschaft in die Welt verkaufen konnte, um ein Vielfaches gemehrt hatten.
Einer der alten Brennmeister, mit denen etwa Hein zu tun gehabt haben durfte, war jüngst verstorben.

Beunruhigte Stimmen waren bereits laut geworden, die fürchteten, dass unvergleichliche Meisterwerke der Rumbrennerei mit dem Mann ins Grab gelegt worden sein könnten – schlimmer noch, für immer verloren sein könnten, fortgewischt mit dem aus dem Leib gefahrenen Geist!
Ich für meinen Teil wehrte mich nach besten Stücken gegen solche Panikmache. Rum gehörte zu La Cabeza, wie Bier zu den Kurzbeinen. Was konnte da schon schief gehen? Die Brennerei arbeitete weiter Tag und Nacht... Nur, wie lange noch?
Es war meine Gefährtin Jacky, die sich den Tod dieses Brennmeisters besonders zu Herzen nahm: Ihr Vater war Schmuggler gewesen und hatte auch mit Schwarzbrennerei zu tun gehabt, das wusste ich mich zu entsinnen. Da war es nur natürlich, dass sie, die sie den Rum doch so sehr liebte, sich nun engagierte. Man müsse herausfinden, ob der tote Brenner etwas hinterlassen habe, jawohl. Und zu dem Zweck hatte sie einen unserer neuesten Matrosen, Vasco, auch gleich eingespannt.
Ein junger Mann von vielleicht achtzehn oder neunzehn Lenzen, den eines unserer kleineren Kaperschiffe auf einer Fahrt aufgegriffen hatte. Ausgesetzt auf einer kleinen Insel, mitten auf See! Das schrie danach, dass er sich in der Marine schlimmste Insubordination hatte zu Schulden kommen lassen. Kurzum: Der richtige Mann für die Mannschaft!
Jener Junge, der zudem mit zweitem Vornamen so hieß, wie der Sohn von Jack und mir kristallisierte sich als ein Landsmann heraus. Drachenfelser war er, durch und durch! Es erfüllte mich mit echter Freude, einen weiteren Kameraden von der Insel hier zu haben. Und mochte er noch so insubordinant sein. Jener Drachenfelser Landsmann hatte sich in den letzten Tagen als sehr wacker gezeigt. Zuerst hatte er in einem waghalsigen Manöver, so wusste Jacky mir zu berichten, ein Fernrohr von einer in der Bucht liegenden Statue geholt – dazu später mehr – und dann auch noch meine Gefährtin vorm Ersaufen im Sumpf westlich von Bajard bewahrt!
Zwecks der Nachforschungen zum Brennermeister waren wir nämlich in die Brennerei auf Cabeza gegangen und hatten sie durchforstet. Das heißt eher: Jack und Vasco suchten, ich passte auf, nicht zu Unrecht. Ein Fass, das sich Vascos allzu sehr annahm, ging bei dessen Befreiung daraus zu Bruch und zu allem Übel zog sich Jack im weiteren Verlauf der Suche eine Verletzung an der Hand zu. Als nämlich das Obergeschoß an der Reihe war, machten die zwei eine verdächtige Bodendiele aus, die Vasco sogleich anhob, um Jack einen Blick darunter zu ermöglichen. Während ich mit einer vom nahen Stützpfeiler gegriffenen Laterne leuchtete, kruschelte sie unter der Diele, ziellos, bis es einen Schlag tat und Jacky schreiend hochfuhr. Die zum Vorschein kommende Hand zeigte rasch den Übeltäter: Eine Schlagfalle gegen Ratten! Nach dem ersten Schrecken lachte Vasco heiter auf, worauf ich desgleichen einstieg, doch allzu rasch wieder entsagte, als sich in das Zetern von Jack ein Heulen mischte. Kurzerhand ließ ich die Laterne fahren und schloss zu der herumspringenden Jack auf, um mich der versehrten Hand und der Schlagfalle anzunehmen. Wahrlich, das musste ordentlich wehgetan haben. Ratten waren bekanntlich weit größer und kräftiger, umso stärker fiel auch diese Falle aus und pflichtschuldigst war die Hand bereits am Anschwellen. Mit findigen, schnellen Griffen war die Falle von der Hand gelöst, Vasco, der sich gefangen hatte, mit der Laterne dazu gekommen. Was sich im Schein des Lichts darbot, verhieß für die nächsten Tage Schmerzen beim Bewegen. Es würde einen deftigen Bluterguss geben. Nachdem der Vorschlag, auf das versehrte Glied zu pissen mit einer klaren Mehrheit von zwei zu eins abgelehnt worden war, ergoss sich schon bald eine gleichmäßig aufgetragene Menge kühlen Süßwassers aus meinem Wasserschlauch über Jacks Hand. Kühlung war das einzige, was man im Moment tun konnte. Ihre Reaktion auf die Berührung des Wassers ließ darauf schließen, dass es ernstlich schmerzte. Seedienst würde also flach fallen. Was musste meine Liebe auch immer für Sachen machen? Mir war es lieber, wenn ich in die Scheiße geriet, nicht sie. Verdammte Brennerei, verdammte Neugier und dreimal verdammte Rattenfallen!
Tags darauf, als ich früh unser Heim verließ, war die Schwellung immer noch vorherrschend, ja, sogar stärker geworden – trotz Kühlung. In Gedanken bei der Umwälzung der Für und Wider eines Besuchs bei der Heilerin Liliana in Adoran verließ ich leise die Bude, um die schlafende Jacky nicht zu wecken und machte mich auf den Weg zur Werft. Wenn die Arbeit dort getan war, galt es, noch einen Kontrollbesuch auf der Krautplantage zu machen. Der Hunger der Bruderschaft nach Kraut war wie immer nur schwer zu stillen – Kunden saßen an allen Küsten der Weltmeere.
_________________
Jaron "Lysander" Sylva, Kapitän der Namenlosen
"Krieg, Handel und Piraterie,/Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Mephistopheles, Faust II
Zuletzt bearbeitet von Jaron Sylva am 03 Feb 2011 17:06, insgesamt 4-mal bearbeitet |
|
| Nach oben » |
|
 |
|
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
|
 |
|
|
 |
|



